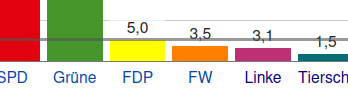Da mich der Landessprecher der Bremer LINKEN ausdrücklich darum gebeten hat, seinen (unten verlinkten) Diskussionsbeitrag zur Krise der Partei zu „zerreißen“, tue ich ihm hiermit diesen Gefallen. Außerdem hat der Text den großen Vorteil, daß er sich mit den politischen Schlüsselproblemen der LINKEN, insbesondere mit der Regierungsfrage und dem Verhältnis zur Sozialdemokratie auseinandersetzt, was leider auch viele VertreterInnen der Parteilinken in der Vorbereitung des Göttinger Parteitags vermieden und sich stattdessen auf unpolitische Personalquerelen beschränkt haben.
von Heino Berg, Göttingen
Christoph Spehr empfiehlt der Partei, ausgerechnet in den Punkten von „Oskar zu lernen“, wo dessen Strategie des „sozialen Korrektivs“ für die Sozialdemokratie und der Orientierung auf eine rotrotgrüne Regierungskoalition in den Ländern und im Bund gescheitert ist.
„Lafontaine bot damit den WählerInnen die Hebelwirkung einer kleinen Partei in klassischer Weise an und setzte die SPD mit klassisch sozialdemokratischen Forderungen maximal unter Druck.“
Spehrs Schlussfolgerung: „Die LINKE muss ihr besonderes Verhältnis zur SPD und zu den Gewerkschaften anerkennen, als Nähe und als Spannung. Sie darf keine Angst vor „sozialdemokratischen Werten“ haben, sie muss auch hier Ja zu der Hebelwirkung sagen, die SPD wieder ein Stück aus der neoliberalen Hegemonie herausdrängen zu wollen. Die LINKE muss das wirklich wollen, es ist Teil ihrer Aufgabe und ihrer Akzeptanz, sie muss sich eine bessere SPD aktiv wünschen und sie fordern.“
Trotz der katastrophalen Erfahrungen mit dem rotgrünen Senat in Bremen geht Spehr weiterhin davon aus, daß es immer noch einen grundsätzlichen Unterschied zwischen der SPD und den anderen bürgerlichen Parteien geben würde und setzt die SPD in ihrem „Klassenbezug“ mit den Gewerkschaften gleich. Die Aufgabe der LINKEN besteht deshalb für ihn darin, die SPD an ihre historischen Wurzeln zu erinnern, sie zu „verbessern“, nach links zu drängen und auf dieser Grundlage Regierungskoalitionen mit ihr zu bilden.
Auch wenn die SPD selbstverständlich andere historische und soziale Wurzeln hat als CDU und FDP: Irgendwann schlagen quantitative Veränderungen (also die jahrzehntelange Anpassung an die bürgerliche Ordnung) in qualitative um. Schröder und Blair hatten in ihren Bemühungen, die Verbindungen zur traditionellen Arbeiterbewegung zu kappen, Erfolg. Die Sozialdemokratie wird – nicht nur in Gestalt der griechischen PASOK – mittlerweile in ganz Europa als Motor der Kürzungspolitik wahrgenommen, mit der das Kapital die – auch von der Sozialdemokratie eingeführten – sozialen Errungenschaften restlos zertrümmert. Dies hat objektive Ursachen: In der schwersten Krise des Kapitalismus seit 80 Jahren fehlt diesem System und den Parteien, die es um jeden Preis retten wollen, der Spielraum für die Zugeständnisse der Aufschwungphase nach dem Weltkrieg.
Diese fundamentalen Veränderungen in der Rolle der Sozialdemokratie spiegeln sich in den Erwartungen der meisten Wähler und Mitglieder der SPD: Während sie früher als eine Partei betrachtet wurde, die sich mit Reformen einer neuen, sozialistischen Gesellschaft annähern wollte, wählt man sie heute – wenn überhaupt – nur noch als „kleineres Übel“ unter den prokapitalistischen Parteien. Immer größere Teile der Bevölkerung wenden sich aber ganz ab und bleiben bei Wahlen zu Hause.
Dies unterscheidet die SPD von den Gewerkschaften, die – bei aller Kritik an ihrer Führung – immer noch als Interessenvertretung der Lohnabhängigen gesehen wird.
Ohne diesen aktiven Erwartungsdruck der früheren SPD-Mitglieder- und Wählerbasis entfällt die objektive Grundlage dafür, diese Partei „nach links“ drängen zu können. Die SPD-Führung kann zwar in der Opposition (und in Zeiten relativer Ruhe) aufholen und von der Wut auf die Regierungsparteien geringfügig profitieren, bleibt aber auch als Oppositionspartei im Bundestag in allen wichtigen Fragen auf Regierungslinie. Zugeständnisse an die LINKE , z.B. bei Mindestlohn, bei der Finanztransaktionsteuer oder bei „Wachstumsergänzungen zum Fiskalpakt“ bleiben rein rhetorisch, weil sie das Kapital nichts kosten dürfen. Wenn die LINKE richtige Teilforderungen von der Eigentums- und Machtfrage trennt, reicht diese „rhetorische“ Übernahme zur Schwächung der Linkspartei aus. Ein „Politikwechsel“, der diesen Namen verdient, ist damit definitiv nicht verbunden. Eine wirkliche Verbesserung der Lage der abhängig Beschäftigten ebenso wenig. Wer diese rein taktischen Zugeständnisse als „Übereinstimmung“ der LINKEN mit anderen Parteien bezeichnet und daraus die Koalitionsfähigkeit für die LINKE ableitet, wie das der Leitantrag tut, lügt sich und der Bevölkerung in die Tasche.
Die „Hebelwirkung“ der LINKEN auf SPD und Grüne, die Christoph Spehr unter Berufung auf Lafontaine als Hauptaufgabe unserer Partei innerhalb dieses angeblich „linken rotrotgrünen Lagers“ beschreibt, entpuppt sich damit als Strategie zur Aushebelung der der LINKEN selbst. Sie macht sich damit einfach überflüssig. Für bloße Reformversprechungen (nicht für ihre Durchsetzung !), für die Politik des „kleineren Übels“ im Rahmen der Bankrottverwaltung des Systems wählen diejenigen, die sich überhaupt noch an dieser Veranstaltung beteiligen, die SPD, die Grünen – oder die Piraten, die wenigstens im Habitus den Anschein erwecken, anders als die etablierten Parteien zu sein.
Im Umgang mit der Regierungsfrage verwechselt Christoph Spehr die Ermöglichung von rotgrünen Landesregierungen (wie in Hessen oder NRW) mit deren Tolerierung. Es war richtig, daß die NRW-LINKE der Ablösung von Rüttgers durch Kraft nicht im Wege stand, aber nicht, um die rotgrüne Minderheitsregierung und ihren Haushalt zu dulden, sondern nur, um fortschrittliche Einzelmaßnahmen (wie die Abschaffung der Studiengebühren) zu erlauben. Selbstverständlich muss eine linke Partei dazu bereit sein, ähnlich wie Syriza in Griechenland Regierungsverantwortung für einen Bruch mit den Kürzungsdiktaten der EU und mit den Interessen des Kapitals zu übernehmen: Aber nur zusammen mit anderen antikapitalistischen Parteien – und nicht etwa zusammen mit der griechischen Sozialdemokratie (PASOK)! Wenn Syriza mit den Kürzungsparteien des EU-Memorandums eine Koalition bilden würde, wie das Christoph Spehr der LINKEN unter der einzigen Bedingung empfielt, das sich eine solche Regierung von einer SPD-Alleinregierung „unterscheiden“ müsse, würde sich die griechische Linke in den gleichen Abgrund stürzen, in dem die italienische Rifundazione bereits gelandet ist.
Man kann von Lafontaine viel lernen, was die Verbindung von Tagesfordungen mit grundsätzlicher Systemkritik angeht. Das „Geheimnis“ seiner Wahl- und Parteireden bestand vor allem darin, daß er – im Gegensatz zu den übrigen Parteien und leider auch vielen VertreterInnen der Linkspartei – diese grundsätzlichen Fragen immer wieder aufgeworfen und – zumindest abstrakt – mit sozialistischen Perspektiven in scharfer Kritik an der Sozialdemokratie beantwortet hat. Daran kann die neue Parteiführung anknüpfen, wenn in Göttingen eine klare und inhaltliche Richtungsentscheidung gegen diejenigen fällt, die die LINKE in einen Mehrheitsbeschaffer für Rotgrün verwandeln wollen. Die SPD geht nur dort auf diese Anbiederung ein, wo die LINKE wie in Brandenburg für die Umsetzung von Sozial- und Stellenabbau zur Verfügung steht.
Der Diskussionsbeitrag des Landesssprechers der Bremer LINKEN hat gute Fragen aufgeworfen, aber seine Antworten führen die Partei endgültig aufs Abstellgleis.