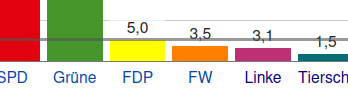Mit bürokratischen Strukturen und einer Fixierung auf parlamentarische Arbeit zur neuen Linkspartei. Chancen für eine an Gewerkschaften und sozialen Bewegungen ausgerichtete Politik gibt es aber immer noch
Mit bürokratischen Strukturen und einer Fixierung auf parlamentarische Arbeit zur neuen Linkspartei. Chancen für eine an Gewerkschaften und sozialen Bewegungen ausgerichtete Politik gibt es aber immer noch
von Lucy Redler
Dieser Artikel erschien in der jungen Welt, 20.3.2007
Was für ein Widerspruch: Einerseits der rasante Aufbau der Wahlalternative Arbeit und soziale Gerechtigkeit (WASG) und der Erfolg der gemeinsamen Kandidatur von WASG und Linkspartei.PDS bei der Bundestagswahl 2005. Wie viele euphorische Reden über die »historische Chance der Einheit der Linken« haben wir seitdem gehört! Auf der anderen Seite heute die Realität: Die Dynamik des WASG-Aufbaus ist vorbei. Die Ausstrahlungskraft der Idee einer vereinigten Linken hat sich verflüchtigt. Beide Parteien verlieren in der Gesamtbilanz Mitglieder. Statt der Wahrnehmung einer historischen Chance werden wir Zeuge einer verpaßten Chance.
Anfangs große Ausstrahlung
Die WASG begann nicht widerspruchsfrei. Von ihren Gründervätern war sie als Top-Down-Projekt konzipiert. Ihre Programmatik ging nicht über die Grenzen des Kapitalismus hinaus, sondern verharrte in keynesianischen Umverteilungswünschen. Und doch war sie für die Arbeiterbewegung und die Linke in Deutschland ein wichtiger Schritt voran. Sie setzte die Idee auf die Tagesordnung, daß abhängig Beschäftigte und Erwerbslose eine eigene politische Interessenvertretung brauchen, die nicht auf Regierungsbeteiligung mit neoliberalen Parteien setzt. Das führte zu ihrer großen Ausstrahlungskraft, vor allem auch unter Gewerkschaftern und Aktiven der Bewegung gegen »Hartz IV«.
Die WASG war Opposition und erschien als neue, unverbrauchte Kraft. Sie zog in ihrem Gründungsprogramm und in Wahlprogrammen eine zentrale politische Lehre aus der Rechtsentwicklung von SPD, Grünen und Linkspartei.PDS: Sie lehnte Regierungsbeteiligungen ab, die zu Sozialabbau und Privatisierungen führen. Dies war der zentrale Punkt, der die WASG von allen anderen Parteien unterschieden hat. Zudem hatte sie eine enge Verbindung zu Gewerkschaften und sozialen Bewegungen. Die WASG war nicht Teil des Establishments.
Die damalige PDS war dagegen eine Partei im Niedergang, unfähig, größere und vor allem aktive Unterstützung in der Masse der arbeitenden Bevölkerung und der Jugend zu erlangen. Auf dem Papier noch sozialistisch, hatte sie die Marktwirtschaft nicht nur akzeptiert, sondern betätigte sich in Landesregierungen und Kommunalparlamenten als Verwalterin von Sozialabbau und Privatisierungen. Dominiert vom hauptamtlichen Apparat und den Parlamentsfraktionen und überaltert, fehlte ihr ein demokratisches Innenleben. Für viele Menschen in West und Ost, die sehr wohl offen für eine antikapitalistische Alternative sind, war und ist die Linkspartei.PDS keine glaubwürdige Alternative aufgrund ihrer Vergangenheit als stalinistische DDR-Staatspartei.
Deshalb war die Gründung der WASG richtig und ein Fortschritt für die Arbeiterbewegung und die Linke. Sie bot die Chance, eine kämpferische und antikapitalistische Partei zu entwickeln, während die Linkspartei.PDS in ihrem Anpassungskurs an den Kapitalismus schon so weit gegangen war, daß es unmöglich erschien, einen Kurswechsel zu erreichen.
Votum für Parlamentarismus
Ironischerweise zitierte damals gerade Oskar Lafontaine im Bundestagswahlkampf den französischen Schriftsteller Victor Hugo (1802–1885) mit dem Satz »Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist.« Aber für was war eigentlich die Zeit gekommen? Für einen Beitritt der WASG in die Linkspartei.PDS? Für bürokratische Methoden und eine hauptsächlich parlamentarisch orientierte Politik? Oder war die Zeit gekommen für eine kämpferische Mitgliederpartei, die in Opposition zu den Herrschenden steht, sich an keinen Regierungen mit neoliberalen Parteien beteiligt und einen Schwerpunkt auf den außerparlamentarischen Widerstand legt?
Trotz radikaler Reden von Oskar Lafontaine stehen er und die große Mehrheit im WASG-Bundesvorstand für den ersten Weg und haben in der Partei einen bürokratischen Kurs durchgesetzt. Dieser fand seinen Höhepunkt in der Absetzung der Landesvorstände in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern im vorigen Jahr, weil beide nicht bereit waren, die Regierungspolitik der jeweiligen Landesverbände der Linkspartei.PDS zu unterstützen.
Die Politik der WASG wird mittlerweile in der Bundestagsfraktion gemacht. In der Programm- und Strukturdebatte hatte die Parteibasis kaum Möglichkeiten, Entscheidungen zu beeinflussen. All das hat viele Mitglieder frustriert; teilweise verlassen sie die Partei auch. Sogar um die Beschlüsse des letzten Bundesparteitags im November 2006 zum Programm der neuen Partei wurde von der Mehrheit des Vorstandes nicht gekämpft und die Inhalte dementsprechend in den Entwürfen der Dokumente auch nicht berücksichtigt. In der politisch zentralen Frage hat sich die Position der Linkspartei.PDS durchgesetzt: Regierungsbeteiligungen mit neoliberalen Parteien, die zu Sozialabbau und Privatisierungen führen, werden nicht ausgeschlossen. Damit fällt die neue Partei programmatisch hinter das zurück, was die Wahlalternative erreicht hatte.
Das Einknicken in der Frage der Regierungsbeteiligung hat seinen politischen Ursprung zweifellos in der begrenzten keynesianischen Programmatik, in der eine Mitgestaltung des Kapitalismus angelegt war. Ich habe in den Programmdebatten in der Partei immer die Position vertreten, daß die Forderungen im Rahmen einer kapitalistischen Gesellschaft nicht dauerhaft erreichbar sind und deshalb ein sozialistisches Programm und eine Perspektive zur Überwindung des Kapitalismus nötig sind. Um diese Frage gab es lebendige Debatten und Auseinandersetzungen. Die Prämisse, nicht an Sozialabbau betreibenden Regierungen teilzunehmen, war aber nahezu unumstritten. In der politischen Praxis hätte diese bei weiterer gemeinsamer politischer Aktivität und Debatte, die Frage einer sozialistischen Programmatik zwangsläufig auf die Tagesordnung der WASG gesetzt.
Dies wurde durch die Orientierung der Mehrheit des Bundesvorstandes auf eine Vereinigung mit der Linkspartei.PDS untergraben. Der Höhepunkt war der Aufruf, im Berliner Wahlkampf 2006 die Berliner Linkspartei.PDS zu unterstützen. Deren Niederlage war deshalb auch eine für die WASG-Führung. Hätte sie den Berliner Landesverband unterstützt, gäbe es heute eine kämpferische, linke Oppostion im Abgeordnetenhaus.
Alternativen zum neoliberalen Weg
Der Unmut über die Art der Fusion und die Politik der Linkspartei.PDS in Berlin ist in der WASG weiterhin groß. Das Selbstvertrauen der Mitglieder, einen eigenen Weg gehen zu können, ist jedoch gebrochen. Gebetsmühlenartig wurde und wird von den Parteispitzen wiederholt, daß es in Deutschland keinen Platz für zwei linke Parteien gibt. Warum die Wahlalternative sich dann überhaupt gegründet hat, beantwortet ihr Vorstand nicht.
Ich bin davon überzeugt, daß ein anderer Weg möglich gewesen wäre. Man hätte die WASG als Oppositionspartei aufbauen und einige zehntausend Mitglieder gewinnen können. Dafür hätte es einer Ausrichtung auf Kampagnen und auf die praktische Unterstützung sozialer Bewegungen sowie betrieblicher Kämpfe und einer konzentrierten Mitgliedergewinnung bedurft. Eine solche Partei hätte das Vertrauen gewerkschaftlicher Aktivisten, von Globalisierungskritikern, Antifaschisten und Aktiven sozialer Bewegungen und linker Gruppen aufbauen und zu einer wirklichen Sammlungspartei werden können. Sie wäre ein großer Schritt nach vorn gewesen, um einen Beitrag zum Aktivwerden von Erwerbslosen und abhängig Beschäftigten zu leisten.
Eine solche WASG hätte einen ganz einfachen Appell an die Linkspartei.PDS richten können: Beendet Eure Beteiligung an Sozialabbau, Privatisierungen, Lohnkürzungen und Arbeitsplatzvernichtung – und wir können ein Zusammengehen beraten! Entweder hätte das die Linkspartei.PDS so unter Druck gesetzt, sich zu ändern– was ich sehr bezweifle –, oder aber die linken, antikapitalistischen Kräfte hätten sich der WASG anschließen können.
Keine Einheit der Linken
Die neue Partei wird sich als die »Einheit der Linken« präsentieren. Doch dies ist ein Mythos. Die Politik der Berliner Linkspartei.PDS, die vom Parteivorstand und der Mehrheit der dominierenden Ost-Landesverbände unterstützt wird, ist nicht links. Auch nicht, Wohnungen zu verkaufen und den Blinden das Blindengeld zu kürzen. Es ist nicht links, Tarifverträge zu untergraben. Eine Politik des kleineren Übels ist nicht links. Links sein bedeutet, sich in der Klassengesellschaft klar auf der Seite der Entrechteten, vom Sozialabbau und Arbeitgeberangriffen Betroffenen zu positionieren, anstatt die Rolle des Vollstreckers neoliberaler Politik zu spielen.
Deshalb werden viele linke Aktivisten der neuen Partei nicht beitreten. Auch unter diesem Gesichtspunkt betrachtet, wird die neue Partei nicht die »Einheit der Linken« repräsentieren. Aus diesen Gründen ist der Beitritt der WASG in die Linkspartei.PDS ein Schritt in die falsche Richtung und wird den Prozeß hin zu einer kämpferischen Interessenvertretung für Erwerbslose und abhängig Beschäftigte verkomplizieren.
Der Landesparteitag der WASG Berlin hat am 10. Februar richtigerweise beschlossen, die Mitglieder aufzurufen, in der kommenden bundesweiten Urabstimmung gegen die Fusion zu stimmen.
Lafontaine und Berlin
Oskar Lafontaine hat jetzt die Privatisierung der Berliner Sparkasse zum »Lackmustest« der neuen Linken erklärt. Die Privatisierung der Sparkasse wird von der Berliner Linkspartei.PDS immer wieder als eine zwingende EU-Auflage dargestellt. Diese Behauptung stimmt jedoch nicht. Es gibt eine EU-Auflage, nach der die Berliner Bankgesellschaft verkauft werden soll. An keiner Stelle ist jedoch davon die Rede, daß dies auch zwingend auf die Berliner Sparkasse zutrifft. Im Gegenteil hat der Senat von SPD und Linkspartei.PDS im Jahr 2005 erst ein Sparkassengesetz geschaffen, was den Verkauf an private Investoren ermöglicht. Ähnlich wie der Länderrat der WASG und neun Mitglieder der Bundestagsfraktion Die Linke forderte Oskar Lafontaine die Berliner Linkspartei.PDS jetzt auf, die Koalition zu verlassen, wenn es zur Privatisierung der Sparkasse kommt.
Es ist zu begrüßen, daß Oskar Lafontaine sich in dieser Form positioniert. Ich lade ihn ein, die Kampagne der WASG Berlin gegen die Privatisierung der Sparkasse sowie das geplante Volksbegehren aktiv zu unterstützen. Wenn er es ernst meint, müßte er diese Auseinandersetzung nutzen, um die kritischen Mitglieder beider Parteien gegen die Politik des Berliner Senats zu mobilisieren, und eine ernsthafte innerparteiliche Auseinandersetzung führen. Der Kampf gegen die Privatisierung der Sparkasse müßte als Hebel genutzt werden, um die gesamte Senatspolitik in Frage zu stellen und eine Kampagne für einen Bruch der Linkspartei.PDS mit der SPD zu führen. Das geschieht nicht. Lafontaine hat schon des öfteren radikale Forderungen aufgestellt und in den entscheidenden Momenten dann doch die Regierungsbeteiligung der Linkspartei.PDS in Berlin unterstützt. Im Interview mit der Welt vom 1. März 2007 verteidigt er die Politik des Berliner Senats. Im Wahlkampf attestierte er der Berliner Linkspartei.PDS sogar eine sozial ausgewogene Politik.
Ist Berlin eine Ausnahme oder ein Präzedenzfall für die neue Linke? Zwei Fragen sind hier entscheidend: 1. Wer wird in der neuen Partei das Sagen haben? 2. Wird die neue Partei eine große Zahl von Arbeitern, Erwerbslosen und Jugendlichen anziehen können, die Druck für eine andere Politik machen könnten?
Es spricht viel dafür, daß der Parteiapparat und die Fraktionen die Partei dominieren werden. Ich glaube, daß Berlin kein Einzelfall bleiben wird, sondern ein Präzedenzfall ist. Bei der Versammlung der Fraktionsvorsitzenden der Linkspartei.PDS in Dessau im Februar hat sich die Versammlung demonstrativ hinter den Kurs der Berliner Parteikollegen gestellt. In Brandenburg steht die Linkspartei.PDS in den Startlöchern, um in die Regierung zu kommen. Und selbst Oskar Lafontaine, der oftmals gegen die Politik des Berliner Senats auftritt, kündigte auf dem letzten WASG-Bundesparteitag an, daß er nach der nächsten Landtagswahl Ministerpräsident im Saarland werden möchte – ohne dafür irgendwelche inhaltlichen Bedingungen an eine Koalition zu knüpfen.
Aussichten für die neue Partei
Trotz der verlorenen Anziehungskraft wird die neue Partei in Westdeutschland anders zusammengesetzt sein und vor allem anders wahrgenommen werden als in Ostdeutschland oder in Berlin. Im Osten und in Berlin ist sie an Regierungen im Land oder in den Kommunen beteiligt, setzt dort unsoziale Politik um und wird als etablierte Kraft gesehen. Sie ist in den Staatsapparat integriert und hat eine ausschließlich parlamentarische Orientierung. Die neue Partei wird dadurch im Osten eine reine Fortsetzung der alten Linkspartei.PDS sein.
Im Westen ist das anders. Hier ist die neue Partei in keiner Regierung und wird als Teil der Linken und der Gewerkschaftsbewegung wahrgenommen. Auch Oskar Lafontaine gibt der Partei im Westen mit seinen oftmals radikalen Reden und Auftritten vor streikenden Belegschaften ein anderes Gesicht. Im Westen wird sich ein Teil von linken und antikapitalistischen Aktivisten entscheiden, in der Partei für einen Kurswechsel einzutreten. Dies ist angesichts einer fehlende massenwirksamen Alternative nachvollziehbar. Aber die Politik der neuen Partei wird auch im Westen von der parlamentarischen Orientierung ihrer Führung geprägt sein, weshalb dort ebenso ein bürokratischer Zentralismus das Parteileben dominieren wird. Das wird die Ausstrahlungskraft begrenzen. Hinzu kommt, daß zu wenig zur praktischen Unterstützung von sozialen Bewegungen oder betrieblichen Kämpfen beigetragen und für solche nicht offensiv genug eine politische Perspektive aufgezeigt wird.
Trotzdem wirkt die neue Partei auf die Gewerkschaften unterschiedlich. Das wurde vom Landesparteitag der WASG Berlin wie folgt zusammen gefaßt: »In den Gewerkschaften wird die neue Partei eine widersprüchliche Wirkung haben. Einerseits hilft ihre Existenz, den Bruch von Teilen der Gewerkschaft mit der SPD zu befördern, wie er sich jetzt zum Beispiel bei der Frage des politischen Streiks zeigt. Andererseits betreibt die Führung von WASG und Linkspartei.PDS einen unkritischen Schulterschluß mit den sozialdemokratischen Gewerkschaftsführungen und hilft diesen so, die Kontrolle über Proteste zu behalten und eine bremsende Rolle zu spielen.«
Ob sich eine größere Zahl von Arbeitern und Jugendlichen der neuen Partei anschließen wird, ist offen. Sie tun es sicher nicht, weil die Politik der »neuen Linken« besonders attraktiv für sie wäre. Wenn es zu weiteren Regierungsbeteiligungen kommt, wäre das noch unwahrscheinlicher. Aber mangels einer starken, antikapitalistischen Alternative wird die neue Partei bei Wahlen Erfolge erzielen und, vor allem in Westdeutschland, neue Mitglieder anziehen können.
Offen ist auch, wie sich der neu zu gründende Hochschulverband der Linken entwickeln wird. Erste Erfahrungen wie bei der Studentenparlamentswahl in Hamburg im Januar 2007, wo der neue Hochschulverband keinen einzigen Sitz eroberte und parteiunabhängige linke Listen erfolgreich waren, machen den Wunsch nach parteiunabhängigen Hochschulverbänden deutlich. Trotzdem kann die Entwicklung nicht vorhergesagt werden, wenn sich der neue Verband ein radikales, am Sozialistischen Deutschen Studentenbund (SDS) angelehntes Image gibt. Auch die Landtagswahlen in Bremen können noch einmal zu erhöhter Aufmerksamkeit und Eintritten in die Partei führen.
Ein qualitativ größerer Zulauf ist jedoch nur denkbar, wenn es zu großen Klassenkämpfen kommt und aus diesen heraus eine Schicht von Aktivisten die Schlußfolgerung zieht, sich politisch zu organisieren. Sollten sie dann den Weg in die neue Partei finden, müssen Sozialisten dort sein, um mit ihnen für einen Kurswechsel zu kämpfen. Ein Teil von linken und sozialistischen Kräften, auch die Sozialistische Alternative Voran (SAV) in Westdeutschland, werden deshalb aus der neuen Partei nicht austreten. Andere werden sich gegen die Neugründung entscheiden. Aus meiner Sicht ist es von großer Bedeutung, daß sich diese Kräfte in einem breiten antikapitalistischen Netzwerk zusammenschließen und gemeinsam handlungsfähig werden. Die bisher bestehenden kritischen Strömungen innerhalb der beiden Parteien können diese Aufgabe alleine nicht erfüllen.
Opposition in Berlin
Was ist die Aufgabe von sozialistischen und antikapitalistischen Kräften in Berlin? Unter der Landesregierung von SPD und Linkspartei.PDS werden der Sozialabbau und die Privatisierungspolitik fortgesetzt. Obwohl es laut Koalitionsvertrag keine Verkäufe von Wohnungen mehr geben sollte (nachdem in der vergangenen Legislaturperiode 120000 Wohnungen verkauft wurden), wurden allein seit der letzten Wahl über 5000 Wohnungen veräußert. Der Ladenschluß wurde faktisch abgeschafft. Die Profilierungsprojekte der Berliner Linkspartei.PDS gehen ins Leere. So will sie nun im Rahmen der Bildung eines öffentlichen Beschäftigungssektors für Langzeitarbeitslose 2500 Jobs mit einem monatlichen Bruttolohn von 1300 Euro schaffen. Es ist schon jetzt abzusehen, daß dieser staatlich subventionierte Niedriglohnsektor dazu führen wird, daß reguläre Stellen, zum Beispiel an Schulen, vernichtet werden. Der öffentliche Beschäftigungssektor soll auch davon ablenken, daß man in Berlin plant, die Lohnkürzungen im öffentlichen Dienst von acht bis zwölf Prozent in Form des sogenannten Solidarpakts 2009 weiter fortzuschreiben. In dem Beschluß des Berliner WASG-Landesparteitags heißt es folgerichtig: »Die Fortsetzung des Sozialabbaus in Berlin durch den rot-roten Senat bedeutet, daß wir uns nach einer erfolgten bundesweiten Fusion eigenständig organisieren müssen. Eine nennenswerte innerparteiliche Opposition gegen die Politik der Führung der Berliner Linkspartei.PDS ist auf absehbare Zeit nicht in Sicht. Die Kräfteverhältnisse würden auch durch einen gemeinsamen Eintritt der WASG Berlin in diese Partei nicht nennenswert verändert. Die in dieser Stadt dringend nötige soziale Opposition wäre geschwächt. Wir sprechen uns deshalb für die Bildung einer Regionalorganisation in Berlin aus, die die politische Zielsetzung der WASG Berlin weiter verfolgt.«
50000 Menschen haben die WASG Berlin im Herbst 2006 gewählt. Die WASG Berlin hat gerade eine Kampagne gegen die Privatisierung der Sparkasse begonnen und beteiligt sich an einem Volksbegehren zur Novellierung des Sparkassengesetzes. Wenn es in Berlin gelingt, eine starke Oppositionskraft gegen alle im Berliner Abgeordnetenhaus vertretenen Parteien aufzubauen, kann diese aufgrund des zu erwartenden Widerstandes gegen die Politik von SPD und Linkspartei.PDS großen Zulauf erhalten. Wichtig ist, daß die neue Organisation einen klaren Schwerpunkt in der außerparlamentarischen Arbeit hat und zugleich die Arbeit der 14 Bezirksverordneten der WASG in sieben Bezirksverordnetenversammlungen unterstützt. Ziel muß sein, bei den nächsten Berliner Wahlen eine linke Kandidatur, möglichst mit weiteren oppositionellen Kräften, vorzubereiten.
Das ist kein Rückzug in die Lokalpolitik oder eine »Berliner Brille«. Es wird in den nächsten Jahren darauf ankommen, in vielfältigen Formen linke und antikapitalistische Kräfte zu stärken. Eine Berliner Regionalorganisation wäre nur landesweit organisiert, würde aber politisch bundesweit ausstrahlen und in einem noch zu bildenden Netzwerk mit antikapitalistischen Kräften bundesweit kooperieren. Die fusionierte Partei ist nicht das Ende der Geschichte. Mit zunehmenden Klassenkämpfen wird die Frage einer starken und sozialistischen Massenpartei wieder auf die Tagesordnung kommen. Das wird auch in der neuen Partei zu Differenzierungsprozessen führen und die nächste Runde im Kampf für eine solche Partei, die tatsächlich konsequent die Interessen der abhängig Beschäftigten und Erwerbslosen vertritt, einläuten.
Lucy Redler ist Mitglied im WASG-Bundesvorstand und in der Sozialistischen Alternative, SAV