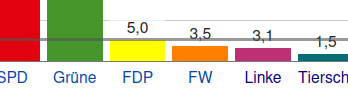Vorschläge zur Programmdebatte auf dem Erfurter Parteitag
Auf ihrem Bundesparteitag vom 21. bis 23. Oktober will DIE LINKE ihr Programm beschließen. Auch wenn Programmtexte nicht unbedingt eine Massenlektüre sind und die politische Praxis auf einem anderen Blatt steht, bleiben sie für die grundsätzliche Orientierung und die Zukunft gerade von neuen politischen Formationen sehr wichtig. Programmatische Richtungsentscheidungen können enorme Rückwirkungen auf die Motivation und Zusammensetzung der Mitgliedschaft entfalten. Dies gilt besonders für eine Partei, die nach beachtlichen Anfangserfolgen und großen Hoffnungen in der Bevölkerung nun seit Monaten stagniert und in der Krise steckt.
von Heino Berg, Göttingen
Die Gegensätze zwischen den Kräften, die eine Annäherung an die Sozialdemokratie suchen, und denen, die die Linkspartei als wirkliche Alternative zu den etablierten Parteien aufbauen wollen, prallen in der LINKEN immer unversöhnlicher aufeinander. Wenn strategische und programmatische Gegensätze in einer Partei aber nicht politisch geklärt werden, äußern sie sich in unfruchtbaren Personalquerelen und lähmen die Organisation – zuerst den Aktivitätsgrad ihrer Mitglieder, in den letzten Monaten auch bei Wahlen.
Nach der Berlin-Wahl
Nachdem die jahrelange Beteiligung der Berliner Linkspartei-Spitze an der unsozialen Regierungspolitik unter SPD-Bürgermeister Klaus Wowereit bei den Abgeordnetenhauswahlen 2006 erst zur Halbierung ihres Stimmenanteils und nun in diesem September zur Abwahl aus der Regierung geführt hat, darf es in Erfurt kein „Weiter so“ geben. Die Aufgabe (und Chance!) eines Programmparteitages besteht gerade darin, durch demokratische Diskussionen der Delegierten inhaltliche Klarheit zu schaffen, wohin die Reise gehen soll. Das ist aber nur möglich, wenn in Erfurt konkrete (Änderungs-)Anträge zur Debatte und Abstimmung stehen, anstatt durch Formelkompromisse in einem (fast einstimmig durch den Parteivorstand verabschiedeten) Programmentwurf unter den Teppich gekehrt zu werden. Hinweise auf vorliegende Alternativ- und Änderungsanträge – wie sie im Kreisverband (KV) Kassel-Stadt, aber auch auf dem Landesparteitag in Nordrhein-Westfalen (NRW) beschlossen wurden – sollen deshalb hier die Kritik am Programmentwurf und am bisherigen Kurs der Partei für die Mitglieder beziehungsweise ihre Delegierten umsetzbar machen.
Zur Entwicklung der Programmdebatte
Ein kurzer Blick zurück erklärt, warum gerade in der Linkspartei so große Gegensätze existieren. DIE LINKE hat als Zusammenschluss von „Wahlalternative Arbeit & soziale Gerechtigkeit“ (WASG) und Partei des Demokratischen Sozialismus (PDS) sehr unterschiedliche historische Wurzeln. Die WASG entstand 2004 als Reaktion auf den politischen Bankrott der Sozialdemokratie mit der Agenda-2010-Politik und war Teil der Anti-Hartz-Bewegung, während der Vorläufer der PDS in der DDR noch eine Staatspartei war und viele ihrer VertreterInnen umgekehrt im Kapitalismus „ankommen“ (so Ex-Parteichef Lothar Bisky) beziehungsweise die Anerkennung in Parlamenten und sogar Regierungen erreichen wollten. Während die PDS formal am Bekenntnis zum Sozialismus festhielt und zugleich in Berlin mit der SPD von 2002 an massiven Sozialabbau praktizierte, blieb die WASG programmatisch sehr beschränkt, wandte sich aber kategorisch gegen Regierungsbeteiligungen auf der Basis von Stellen- oder Sozialkürzungen.
Die Regierungsfrage stand deshalb schon beim Fusionsprozess 2005 bis 2007 im Zentrum der Auseinandersetzungen (insbesondere mit dem Berliner WASG-Landesverband). Da sie auch in den „Programmatischen Eckpunkten“ der vereinigten Partei ausdrücklich offen gelassen wurde, bleibt sie auf dem Programmparteitag in Erfurt der entscheidende Konfliktherd. Auch wenn die parlamentarische Geschäftsführerin der Bundestagsfraktion Dagmar Enkelmann nach dem Debakel der Regierenden in Berlin vor einer „Zerreißprobe“ warnt und ein Festhalten an diesem gescheiterten Kurs in Erfurt anmahnt: Durch Kompromissformeln, welche die politischen Hürden (beziehungsweise „Haltelinien“) für ein Regierungsbündnis mit bürgerlichen Parteien mehr oder weniger „flexibel“ gestalten und Hintertüren dafür offen lassen, würde der Richtungsstreit in der Partei nicht durch die Delegiertenmehrheit entschieden, sondern erneut vertagt – und damit faktisch den Mandatsträgern in den Parlamenten überlassen.
Im Frühsommer hatte der Parteivorstand den Programmentwurf veröffentlicht. Dieses Papier ist bereits eine Überarbeitung des unter anderem von Oskar Lafontaine ursprünglich vorgelegten ersten Entwurfs. Diese Neufassung bedeutet – nach dem monatelangen Sperrfeuer des rechten Parteiflügels – eine Verwässerung wichtiger Schlüsselpositionen.
Minimal- und Maximalprogramm
Das Hauptproblem des nun vorliegenden Entwurfs ist – nicht zuletzt durch die Unklarheiten in der Regierungs- und Machtfrage – die Trennung zwischen den Minimalforderungen für systemimmanente Verbesserungen und der sogenannten „Maximalforderung“ nach Überwindung des Kapitalismus. Wenn es möglich wäre, die Lage der Lohnabhängigen nachhaltig zu verbessern, ohne das Privateigentum an den „strukturbestimmenden Großbetrieben“ in Frage zu stellen und die Vorherrschaft des Kapitals zu brechen, wäre der Sozialismus (ähnlich wie im SPD-Programm) nur ein folgenloses Bekenntnis, mit dem man sich in Sonntagsreden schmückt. Er steht dann zwar noch im Programm (so wie das Paradies in der Bibel), spielt aber in der politischen Praxis keine Rolle mehr.
Demgegenüber ist es nötig, (wie kürzlich auch von der Bundestagsabgeordneten Ulla Jelpke bei der Programm-Konferenz der „Antikapitalistischen Linken“, AKL, vorgeschlagen), Forderungen zur unmittelbaren Verbesserung der Situation zu bündeln und mit Angriffen auf das Privateigentum an den Produktionsmitteln zu verknüpfen, indem zum Beispiel für eine drastische Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohn- und Personalausgleich, für die Offenlegung der Geschäftsbücher und (anstelle von „Mitbestimmung“) für die demokratische Kontrolle und Verwaltung der arbeitenden Bevölkerung über die Produktion mobilisiert wird. Einfach deshalb, weil sich in der Beschränkung auf die sogenannten Sachzwänge des Kapitalismus und der Profitlogik nicht einmal bescheidene Verbesserungen durchsetzen lassen.
Stalinismus
Im Programmentwurf wird das „Staatseigentum“ in Verbindung mit der „historischen Erfahrung“, also den bürokratischen Planwirtschaften zum Beispiel in der DDR, gebracht. Als ob der Umfang und der Zentralisierungsgrad des öffentlichen Eigentums und nicht die politische Unterdrückung (und damit die fehlende demokratische Kontrolle der Produzenten über Wirtschaft und Gesellschaft) die Ursache für ihren Zusammenbruch gewesen wäre!
Auch bei der Aufarbeitung des Stalinismus bezeichnet der neue Entwurf die DDR als „Sozialismusversuch“. Dabei bestand ein Gegensatz zwischen den Bestrebungen der Nachkriegsbevölkerung nach einer sozialistischen Alternative zu Kapitalismus und Faschismus einerseits und den Anstrengungen der staatlichen Bürokratie andererseits, die eine demokratisch-sozialistische Entwicklung verhindern wollte. Gerade in Deutschland, wo die SED den Sozialismus jahrzehntelang in Misskredit gebracht und eine politische Revolution provoziert hat, kann sich DIE LINKE keine Zweideutigkeiten in der Verurteilung des Stalinismus erlauben. Der Ersetzungsantrag des KV Kassel zu den Zeilen 298 bis 301 zieht einen klaren Trennungsstrich zwischen unseren sozialistischen Zielen und dem, was die SED daraus gemacht hat.
Eigentums- und Systemfrage
Im Unterschied zu früheren Programmtexten der PDS und der WASG beschreibt der Entwurf des Parteivorstands die (aktuell vor allem in der Euro-Zone offen ausbrechende) Krise nicht nur als Folge der „neoliberalen“ Wirtschaftspolitik, sondern als unvermeidlichen Ausdruck der Widersprüche des kapitalistischen Systems insgesamt. Das ist ein wichtiger programmatischer Fortschritt, auch wenn an vielen Stellen weiterhin der Eindruck erweckt wird, dass mit einer nachfrageorientierten beziehungsweise keynesianischen Wirtschaftspolitik die Krise auch ohne eine Entmachtung des Großkapitals überwunden werden könnte.
Leider bleibt auch im neuen Entwurf offen, welche Bereiche der Wirtschaft (abgesehen von der „Daseinsvorsorge“) in öffentliches Eigentum überführt werden sollen und ob Letzteres die neue Gesellschaftsordnung qualitativ bestimmen soll. „Strukturbestimmende Großbetriebe der Wirtschaft wollen wir in demokratische gesellschaftliche Eigentumsformen überführen.” Was ist unter „demokratischen Eigentumsformen“ zu verstehen? Der Änderungsantrag des Kreisverbands Kassel würde in dieser fundamentalen Frage Klarheit schaffen, weil hier die notwendige (aber eben nicht hinreichende!) Verstaatlichung mit der demokratischen Kontrolle durch die Produzenten verbunden wird: „Damit die Banken und Großkonzerne nicht mehr die Rahmenbedingungen für die Gesamtwirtschaft diktieren können, müssen sie in öffentliches Eigentum überführt und durch VertreterInnen der Belegschaften und der arbeitenden Bevölkerung verwaltet und kontrolliert werden.“
„Wirtschaftsdemokratie“
Problematisch bleibt auch das Bekenntnis zum so genannten „Belegschaftseigentum“, das in Großbetrieben (wie zum Beispiel Opel) die privaten Anteilseigner ergänzen und an die Stelle ihrer vollständigen Überführung in Gemeineigentum treten soll. Belegschaftsbeteiligungen, auch wenn sie nicht nur als individuelle Mitarbeiteraktien konzipiert sind, überwinden ja nicht das Profitprinzip und seine katastrophalen Folgen für Gesellschaft und Natur. In letzter Konsequenz werden sie im Rahmen einer kapitalistischen Marktwirtschaft deshalb sogar zu einem Hindernis, um die Interessen der gesamten arbeitenden Bevölkerung unabhängig zu vertreten.
Ähnliches gilt für die Neuauflage des sozialdemokratischen Konzepts der „Wirtschaftsdemokratie“, das in den Zeilen 1190 bis 1198 durch die Einrichtung von „Runden Tischen“ sowie „Wirtschafts- und Sozialräten“ konkretisiert wird. Diese sollen „Leitbilder für die Rahmenplanung erstellen und die Möglichkeit zu gesetzgeberischen Initiativen erhalten“. Damit würden diese „Räte“ die Verfügungsgewalt des Privateigentums über die großen Produktionsmittel aber nicht ersetzen, sondern lediglich ergänzen beziehungsweise beratend begleiten. Aus der Entmachtung des Kapitals wird hier eine Strategie der Klassenzusammenarbeit, wie sie von der SPD- und Gewerkschaftsführung seit Jahrzehnten mit bekanntem „Erfolg“ praktiziert wird. Alternativen dazu stehen mit dem folgenden Kasseler Antrag zur Abstimmung: „DIE LINKE tritt dafür ein, dass die Produktion durch Wirtschafts- und Sozialräte kontrolliert und verwaltet wird, in denen direkt gewählte VertreterInnen aus Belegschaften, Gewerkschaften, Kommunen, Verbraucherinnen und Verbrauchern, soziale, ökologische und andere Interessenverbände in einer Form vertreten sind, dass die gewählten VertreterInnen aus der arbeitenden Bevölkerung eine Mehrheitsposition erlangen.“
Die „paritätische Mitbestimmung“ soll im Programmentwurf nur „erweitert“ werden und sieht eine Zusammenarbeit mit privaten Anteilseignern vor, anstatt diese zu enteignen und ihre Verwaltung durch VertreterInnen der Beschäftigten, der Gewerkschaften und gegebenenfalls Verbraucher- oder Umweltschutzorganisationen sowie des Staates „paritätisch“ (also OHNE private Anteilseigner) zu organisieren. Dazu passt, dass ein „Vetorecht“ der Beschäftigten nur für die Schließung von Betrieben gelten soll, die „NICHT von Insolvenz bedroht sind“ (Hervorhebung durch den Autor).
MarxistInnen verteidigen jede (auch noch so begrenzte!) Errungenschaft der Arbeiterbewegung. Das gilt auch für Mitbestimmungsrechte von KollegInnen in den Betrieben. Aber das bedeutet nicht, dass wir in unseren programmatischen Zielen der Mehrheit der Bevölkerung, also den lohnabhängig Beschäftigten und ihren gewählten VertreterInnen nur die Rolle von Mitverwaltern des Profitsystems an der Seite einer winzigen Minderheit von privaten Anteilseignern zugestehen könnten. Wenn das Prinzip der Demokratie in den Betrieben gelten soll, dann haben private Anteilseigner in der Leitung von Unternehmen und Banken nichts mehr zu suchen. Unser programmatisches Ziel ist eben nicht die Mitbestimmung, also die Zusammenarbeit von Arbeit und Kapital, sondern die Emanzipation und gesellschaftliche Selbstbestimmung der Arbeiterklasse.
Israel und Palästina
Auf Druck des Regierungsflügels und seiner Kampagne gegen den angeblichen Antisemitismus in der Linkspartei wurde ein Passus in den Programmentwurf aufgenommen, der in den Zeilen 240 bis 247 eine Kollektivschuld „der Deutschen“ an den Verbrechen des Nationalsozialismus unterstellt. Dies würde die wirklichen Schuldigen, also die NSDAP und das deutsche Kapital, entlasten und den Widerstand gegen den Faschismus ignorieren.
Eine „Beilegung des Nahostkonfliktes im Rahmen einer Zwei-Staaten-Lösung“ ist auf kapitalistischer Basis nicht tragfähig. Die Verpflichtung auf das „Existenzrecht Israels“ (eine Unterstützung des heutigen Staates Israel und damit die Übernahme der „deutschen Staatsräson“, so Fraktionschef Gregor Gysi) fördert nicht die notwendige Debatte über die Palästina-Frage und die Solidarität mit dem Widerstand der jüdischen und palästinensischen Bevölkerung gegen die israelische Regierung, sondern behindert sie, nur um DIE LINKE für bürgerliche Koalitionspartner „regierungsfähig“ zu machen. Der Antrag aus Kassel, diesen Absatz zu streichen, ist deshalb zu unterstützen.
Regierungsfrage
Die wichtigste Veränderung des neuen Programmentwurfs betrifft (wen wundert‘s?) die Regierungsfrage. In den Zeilen 2732 bis 2746 heißt es dazu jetzt: „Regierungsbeteiligungen der LINKEN sind nur sinnvoll, wenn sie eine Abkehr vom neoliberalen Politikmodell durchsetzen sowie einen sozial-ökologischen Richtungswechsel einleiten. DIE LINKE strebt dann eine Regierungsbeteiligung an, wenn wir damit eine Verbesserung der Lebensbedingungen der Menschen erreichen können. So lässt sich die politische Kraft der LINKEN und der sozialen Bewegungen stärken und das bei vielen Menschen existierende Gefühl von Ohnmacht und Alternativlosigkeit zurückdrängen. Regierungsbeteiligungen sind konkret unter den jeweiligen Bedingungen zu diskutieren und an diesen politischen Anforderungen zu messen. Die Entscheidung über Wahlprogramm und Koalitionsvertrag treffen in diesem Sinne die jeweils zuständigen Parteitage. (…) An einer Regierung, die Kriege führt und Kampfeinsätze der Bundeswehr im Ausland zulässt, die Aufrüstung und Militarisierung vorantreibt, die Privatisierungen der Daseinsvorsorge oder Sozialabbau betreibt, deren Politik die Aufgabenerfüllung des Öffentlichen Dienstes verschlechtert, werden wir uns nicht beteiligen.“
Hier wird eine Regierungsbeteiligung der LINKEN, die vor allem in Berlin die sozialen Bewegungen massiv geschwächt hat beziehungsweise immer wieder bei Streiks und sozialen Bewegungen auf der anderen Seite der Barrikade stand, ausdrücklich als das exakte Gegenteil verkauft. Wer als LINKER in Regierungen mit pro-kapitalistischen Parteien Sozialabbau und Tarifflucht organisiert, verstärkt das Gefühl von „Ohnmacht und Alternativlosigkeit“. Die Streichung des früheren Neins zu Stellenstreichungen im Öffentlichen Dienst aus dem neuen Programmentwurf sollte den Verbleib der LINKEN in diesen Landeskoalitionen gestatten, macht aber zugleich die programmatischen Forderungen gegen die Massenarbeitslosigkeit unglaubwürdig. Wie will DIE LINKE den Stellenabbau in der Privatindustrie bekämpfen, wenn sie ihn im Öffentlichen Dienst zulässt? Was bleibt vom Ziel einer „drastischen Arbeitszeitverkürzung“ übrig, wenn dafür nicht neue Stellen geschaffen, sondern bestehende gestrichen werden können? Ein Bevölkerungsrückgang in den entsprechenden Bundesländern ist dafür kein Argument, weil der Öffentliche Dienst ja gestärkt und nicht weiter abgebaut werden soll. Es ist zu begrüßen, dass die NRW-LINKE sich gegen den „Öffentlichen Beschäftigungssektor“ (ÖBS) wendet, wie er in Berlin propagiert wurde und in Brandenburg unter Rot-Rot weiter praktiziert wird, und stattdessen die Schaffung tariflich bezahlter Arbeitsplätze im Öffentlichen Dienst fordert.
Während der frühere Programmentwurf solche Mindestbedingungen für eine Regierungsbeteiligung noch „verbindlich“ erklären wollte, wird nun den LändervertreterInnen der Partei ausdrücklich das Recht eingeräumt, das Programm zu verletzen. (Üblicherweise definiert ein Programm ja den politischen Rahmen, innerhalb dessen die Landesverbände autonom entscheiden können.) Wie sich im neuen Programmentwurf zeigt, sind sogenannte „Haltelinien“ kein wirkliches Hindernis für Koalitionen mit pro-kapitalistischen Parteien, sondern eher eine Beruhigungspille für die Mitglieder und WählerInnen der LINKEN.
Dagegen schlägt der KV Kassel vor: „Regierungsbeteiligungen der LINKEN sind nur sinnvoll, wenn unsere Partei damit zur Mobilisierung der lohnabhängigen Bevölkerungsmehrheit, zu realen Verbesserungen ihrer Lage und zur Überwindung der kapitalistischen Macht- und Eigentumsverhältnisse beitragen kann. Eine Regierungskoalition mit pro-kapitalistischen Parteien, die nur zur Verwaltung des Kapitalismus führen kann, lehnt die LINKE ab. Um Politik im Interesse von Beschäftigten und Erwerbslosen zu machen und unsere Partei weiter aufzubauen, muss DIE LINKE aktiv an Protesten in den Betrieben und auf der Straße teilnehmen. Dort ist unser Platz, nicht in Regierungen an der Seite der Hartz-IV-Parteien. Das gilt auch für eine pauschale Tolerierung von rot-grünen Regierungen. DIE LINKE steht einer Abwahl von schwarz-gelben Regierungen nicht grundsätzlich im Wege. Sie wird die Maßnahmen rot-grüner Regierungen jedoch nur von Fall zu Fall unterstützen, wenn sie tatsächlich im Interesse von Lohnabhängigen, Rentnern und Jugendlichen liegen.“
Gewerkschaften und außerparlamentarische Bewegungen
Der Entwurf läßt offen, ob der programmatische Schwerpunkt der Partei in den Parlamenten oder auf der Straße liegen soll, obwohl zum Beispiel die Massenbewegung für die Abschaltung der AKW gerade erst bewiesen hat, welche Seite in diesem „Wechselspiel“ praktische Veränderungen bewirken konnte – und wer sie allenfalls nachvollzogen und abgeschwächt hat.
„Ein politischer Richtungs- und gesellschaftlicher Systemwechsel lässt sich nicht allein auf parlamentarischer Ebene durchsetzen. DIE LINKE nutzt die Parlamente für die Interessen der arbeitenden Bevölkerung und kämpft auch dort um Mehrheiten. Grundsätzliche und nachhaltige Änderungen sind aber nur durch die Selbstorganisation der Betroffenen möglich. Die aktive Teilnahme am außerparlamentarischem Widerstand ist die wichtigste Aufgabe der LINKEN“ (KV Kassel).
Ausblick
Der Leitantrag des Parteivorstands hält die antikapitalistische Grundtendenz des ursprünglichen und mit Lafontaine verbundenen ersten Programmentwurfs aufrecht, hat aber dem Druck des Regierungsflügels an vielen Punkten bereits im Vorfeld nachgegeben. In der vorliegenden Fassung ist er für SozialistInnen daher nicht zustimmungsfähig.
Obwohl einige WortführerInnen der „Antikapitalistischen Linken“ und der „Sozialistischen Linken“ (wie Sahra Wagenknecht oder Christine Buchholz) diesen Entwurf im Parteivorstand mitgetragen haben, sind Änderungsanträge nicht nur in Kassel, sondern zum Beispiel auch in NRW von der großen Mehrheit der Delegierten auf den Weg gebracht worden. Da Kampfabstimmungen in Erfurt wegen der Änderungswünsche des „Forum demokratischer Sozialismus“ (fds) ohnehin anstehen, gibt es erst recht keinen Grund, antikapitalistische Positionen (zum Beispiel in der Frage der Kriegseinsätze der Bundeswehr, siehe den Artikel auf Seite 4) einem Kompromiss mit dem Regierungsflügel zu opfern, ohne dass die Parteitagsdelegierten darüber selbst entscheiden konnten. Umso wichtiger zudem, dass DIE LINKE NRW die Ablehnung sämtlicher Auslandseinsätze der Bundeswehr oder aber auch den Austritt Deutschlands aus der NATO beantragt hat.
Die leider auch bei VertreterInnen der Parteilinken verbreitete Suche nach Formelkompromissen hat die inhaltliche Debatte in den Hintergrund gedrängt. Der Programmparteitag in Erfurt bietet die Chance, durch klare antikapitalistische Signale an die Parteibasis und an die Bevölkerung endlich wieder in die Offensive zu kommen. Wir sollten sie nutzen!