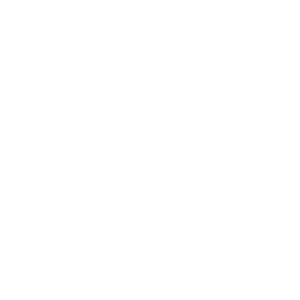Ken Loachs neuer Film “Jimmy’s Hall”
Auf, auf zum Tanz: Regie-Altmeister Ken Loach erzählt in seinem wohl letzten Film “Jimmy’s Hall“ vom Kampf um kulturelle Freiräume und politischem Widerstand gegen die reaktionäre katholische Kirche im Irland der frühen 30er Jahre.
von Benjamin Trilling, Dortmund
Unterdrückende Herrschaftssysteme sind umso armseliger und heuchlerischer, je früher sie sich als natürliche Ordnung erklären. Gewalt, Kontrolle, Lügen – was sich dem auch immer beugen muss, es ist natürlicher Gang. Genau das versucht auch Pfarrer Sheridan dem sozialistischen Freigeist Jimmy Gralton (Jim Norton) zu verklickern. Der hat seinen Gemeindeschuppen wiedereröffnet – ein subversives Zentrum in der provinziellen Ortschaft Leitrim, wo die Leute munter zusammenkommen – um zu tanzen, zu lesen oder politisch zu diskutieren. Dem Geistlichen ist das natürlich ein Dorn im Auge; das katholische Bildungsmonopol ist in Frage gestellt, das ideologische Bollwerk bröckelt. „Erst wird getanzt, dann gelesen“, warnt er. Der Dissident legt diplomatisch die Legitimität der „Pearse-Connoly-Hall“ als Ort des freien Austausches und der Entfaltung dar. Der Pfaffe bleibt stur und verweist auf die „neue natürliche Ordnung der irischen Republik“.
Eine wirklich traurige Szenerie ist es, die Ken Loach in seinem neuen Film zu Beginn einfängt: Immergrüne Weiden, karge Hügel, über die Nieselregen fegt und trostlose Hütten mit feuchten Strohdächern: Schöner könnte das Irland eigentlich gar nicht sein, in das der Sozialist Jimmy Gralton Anfang der 30er Jahre aus dem zehnjährigen Exil in den USA zurückkehrt. Doch auch sein Heimatland ist von der großen Depression geprägt. Die DorfbewohnerInnen drängen ihn dazu, seinen Tanzschuppen wiederzueröffnen. Ken Loach und sein Stammdrehbuchautor Paul Laverty ließen sich in ihrem jüngsten Werk vom Leben der realen historischen Figur James „Jimmy“ Gralton und dessen politischen Kampf um die „Pearse-Connolly-Hall“ als Freiraum für lebendige Diskussionen, Musik, Tanz und Literatur inspirieren. Der Konflikt spielt vor dem Hintergrund der turbulenten 20er und 30er Jahre in Irland: Nach dem Unabhängigkeitskrieg gegen die britische Kolonialmacht wird zwischen den bürgerlichen Kräften und den Briten der Freistaat Irland ausgehandelt. Die irische Republik wird jedoch mit der Teilung des Landes erkauft, der Norden zählt weiterhin politisch zu Britannien, der irischen Gesellschaft droht ein Bürgerkrieg. In dieser aufgeheizten Stimmung sind den Stellvertretern von Politik und katholischer Kirche die sozialistischen Kreise um Jimmy Gralton und deren freigeistiges Kultur-und Gemeindezentrum natürlich ein Dorn im Auge. Daher kommt es zur Flucht in die USA. Nach Jimmys Rückkehr mit der Wiedereröffnung der „Connoly-Hall“ hat sich die Front aus kapitalistischem Staat, reaktionären Großgrundbesitzern und katholischer Kirche stärker denn je gegen alle fortschrittlichen Tendenzen verschmolzen.
Mit „Jimmy’s Hall“ knüpft Loach an seinen ersten Irlandfilm „The Wind That Shakes the Barley“ (2006, Goldene Palme von Cannes) an, der schon das Trauma der britischen Besatzung und den anschließenden Bürgerkrieg filmisch aufarbeitete. Nicht nur in dieser Hinsicht bleibt sich der überzeugte Sozialist Loach treu: Auch die Sozial- und Kapitalismuskritik bleibt in seinem wohl letzten Film tonangebend. Damit machte er schon in seinem Debütfilm auf sich aufmerksam: „Cathy Come Home (1966) schilderte Arbeits- und Obdachlosigkeit eines jungen Paares, denen das Kind durch staatliche Willkür weggenommen wird. Obwohl seine künstlerische Arbeit durch Zensur und Sendeverbote während der Thatcher-Ära isoliert und erschwert wurde, blieb er der Tradition des italienischen Neorealismus treu und schuf mit seinen Schilderungen der britischen oder migrantischen Arbeiterklasse einen sozialrealistischen Stil, mit denen er in Filmen wie „Ladybird, Ladybird“, „Raining Stones“ oder „Riff-Raff“ die Auswirkungen des Thatcher-Neoliberalismus anprangerte.
Nach zuletzt eher seichten proletarischen Komödien („Angel’s Share“, Looking for Eric“) greift er nun neben einem Kapitel der irischen Geschichte und dem religiösem Fanatismus auch eine Sozialkritik kapitalistischer Gewalt und Ausbeutung wieder auf. Während „The Wind That Shakes The Barley“ ein düsterer Film voll roher Gewalt war, ist „Jimmy’s Hall“ umso poetischer. Zwar steht auch der politische Kampf im Vordergund, doch ist es die Lebensfreude der aufmuckenden Dorfgemeinde, die abendlichen Tänze und Feste, die lebendigen Diskussionen, welche die beschränkte katholizistische Hegemonie bloßstellen. In einer Parallelmontage bringt Loach das frech auf den Punkt: Es wird getanzt, gesungen – alte irische Lieder und sehr viel Jazz. Wie diabolisch das ist, wird in der Kirchenpredigt ausgemacht, ja, verteufelte Musik ist dieser Jazz, wie der Pfarrer Sheridan von der Kanzel propagiert: “Rhythmen aus dem dunkelsten Afrika, die Leidenschaften entfachen. Beckenzucken und ständiges schlüpfriges Begrapschen statt der Eleganz und Schönheit unserer irischen Tänze…” Und erst die Ausschweifungen danach: „Spaziergänge mitten in der Nacht, unter den Sternen. Ausfahrten bis zum Morgengrauen in unziemlicher Gesellschaft, mit Männern, die von weit herkommen und hier in ihren Automobilen herumstreifen…” Wo das Grammophon steht, weiß der Pfarrer, steht auch das kommunistische Manifest nicht weit weg; so schnauft er in seiner Predigt durch: „UND – sie sind Kommunisten.“
Kämpferische Lebensfreude und Lebensfreude für den politische Kampf – Loachs Spätwerk bringt das poetisch zusammen: Das Bemühen, der katholischen und reaktionären Ideologie der jungen irischen Republik Freiräume abzuringen, geht in den Widerstand gegen die Zwangsräumungen von Familien aus ihren Häusern durch egoistische Großgrundbesitzer über, später auch gegen die verschworene Allianz aus Kirche, Staat und wirtschaftlicher Macht. Vor dem aktuellen Hintergrund des Vormarsches religiöser Fanatiker, die Musik, Tanz und Sex verbieten wollen, wird vor allem der repressive Charakter von Religion vor Augen geführt. Gleichzeitig ist es aber auch eine Parabel über den Kampf um (kulturelle) Freiräume im Kapitalismus, die Loach inszenziert – mit Tanz und Musik als politische, ja, rebellische Metapher gegen die herrschende Ordnung. Wie natürlich sie auch sein sollen.