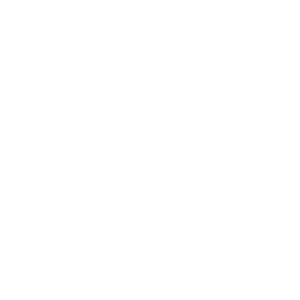Die Folgen eines gescheiterten Systems
Die Folgen eines gescheiterten Systems
Wir veröffentlichen hier einen Artikel eines Lehrers aus Brüssel über die Zustände im Stadtteil Molenbeek, aus dem einige der Attentäter von Paris stammten. Der Artikel erschien zuerst in der Dezemberausgabe der Zeitung der Links-Sozialistischen Partei (Schwesterorganisation der SAV und Sektion des CWI in Belgien).
Dies ist die Geschichte von einem Mann, der aus dem 50. Stock von einem Hochhaus fällt. Während er fällt, wiederholt er, um sich zu beruhigen, immer wieder: „Bis hierher lief´s noch ganz gut, bis hierher lief´s noch ganz gut, …“. Das gegenwärtige Verhalten unserer Politiker hinsichtlich der immensen sozialen Probleme im Brüsseler Stadtteil Molenbeek in den vergangenen Jahrzehnten erinnert an die Eingangsszene aus dem Film „Hass“ (frz.: „La Haine“) aus dem Jahr 1995. Darin geht es um die Aussichtslosigkeit, den Hass und die Frustration einer immer größer werdenden Gruppe von jungen Menschen in den Vorstädten von Paris. Dass eine Gruppe Jugendlicher mit Migrationshintergrund aus Molenbeek nun für abscheuliche Terroranschläge mitverantwortlich sein soll, lässt erahnen, dass nach einem tiefen Fall eine harte Landung folgen wird.
Seit den Terroranschlägen von Paris am 13. November gilt Molenbeek in den internationalen Medien als das europäische Drehkreuz des Dschihadismus und als „Spielwiese für den Terrorismus“, ein „Elendsghetto“ in der Hauptstadt eines „gescheiterten Staates“. Im September sollten wir noch über rassistische Karikaturen in der Presse lachen, in denen Kinder mit Migrationshintergrund aus Molenbeek als Terroristen abgebildet worden sind. Terror ist keine genetische Veranlagung und ganz sicher auch kein kulturelles Phänomen. Es ist die tragische Folge eines Systems, das Millionen von jungen Menschen in den Krieg, in Armut, Frustration und zu enormer Wut treibt. Und dort, wo die Wut nicht in kollektiven Widerstand mündet und zu einer gesellschaftlichen Alternative führt, kann sie zum Nährboden für reaktionäre Fundamentalisten werden. Diese bemächtigen sich einer winzig kleinen Minderheit (0,3 Prozent der jungen Männer aus Molenbeek), die sie glauben machen, dass sie in Syrien tatsächlich eine Zukunft hätten.
Die Situation in Molenbeek ist nicht vom Himmel gefallen. Statt von einem gescheiterten Staat sollten wir besser von einem gescheiterten System sprechen, wenn wir das Problem benennen wollen. So hat der Fernsehsender VRT eine Reportage über Molenbeek aus dem Jahr 1987 noch einmal ausgestrahlt, in der SozialarbeiterInnen schon damals vor einer zunehmenden Radikalisierung und steigender Kriminalität einer Schicht von Jugendlichen aus der zweiten oder dritten Generation von Einwandererfamilien gewarnt haben. Als Grund dafür benannten sie fehlende Lösungen hinsichtlich des Mangels an Arbeitsplätzen, bezahlbaren Wohnungen und die qualitativ mangelhafte Bildung in den betreffenden Wohnquartieren. Dreißig Jahre später liegt die Erwerbslosigkeit in Molenbeek bei rund dreißig Prozent. Für die Gruppe der jungen Leute aus den ärmsten Vierteln geht man sogar von fünfzig bis sechzig Prozent aus. Mit einem durchschnittlichen Jahreseinkommen von 9.844 Euro handelt es sich bei Molenbeek um die zweitärmste Kommune in Belgien. Damit liegt dieser Stadtteil mehr als vierzig Prozent unter dem Einkommensdurchschnitt des Landes. Der Fußballer Vincent Kompany meinte nach den Anschlägen, dass dies nur das Vorspiel gewesen sei, und dass der Fundamentalismus als „die Wut gegen ein System“ verstanden werden muss, „das Menschen ausschließt“.
Als Reaktion auf die Verstrickung belgischer Jugendlicher in die Anschläge von Paris hören wir die Politiker kaum ein Wort über diese Problematik von sich geben. Innenminister Jan Jambon war heuchlerisch genug, um in einem Interview zu sagen, dass er allein Molenbeek nicht „säubern“ könne, aber auch „eine Verbesserung nötig ist, was die Bildung, Fragen der Raumordnung und gleiche Chancen angeht“. Als ob wir schon vergessen hätten, dass die konservative Regierungspartei N-VA (der Jambon angehört) erst vor einem Jahr mit einer umfassenden Kürzungsrunde im flämischen Bildungsbereich für drastische Einschnitte gesorgt hat. Unter anderem wurden dabei mehr als zehn Prozent des Budgets für die Begleitung von Auszubildenden gestrichen. In der Folge schaffte diese Regierung unter der Führung der N-VA im Landesteil Flandern das Kriterium der „sozial-ökonomischen Situation“ bei Auszubildenden ab, was zu einer weiteren Kürzung der Mittel geführt hat.
Die Sicherheitsmaßnahmen, die Mitte November ergriffen worden sind, werden auf die tiefer liegenden Ursachen, die gesellschaftliche Ausgrenzung und die Radikalisierung keine Antwort bieten können. Repression wird den Abstand, der zwischen der Gesellschaft und dieser Gruppe junger Menschen besteht, die dort draußen leben, nur weiter vergrößern. Sicherheit ist zwar wichtig, doch man wird das Gefühl nicht los, dass diese Regierung die Situation bewusst aus dem Gleichgewicht bringt, um grundlegend von der Realität abzulenken. Mit Soldaten, gepanzerten Fahrzeugen, geschlossenen Schulen und Maschinengewehren versucht sie, die Diskussion von der Frage nach den sozialen Verhältnissen wegzubringen. Dass jede Debatte über strukturelle Fehler im politischen System um jeden Preis vermieden werden soll, zeigt sich unter anderem auch an dem Verbot von Demonstrationen gegen den Klimagipfel, das sowohl in Frankreich wie auch in Belgien erlassen worden ist.
Das bringt uns zu der Frage, weshalb diese Regierung nicht einfach entschlossen gegen Jugendarbeitslosigkeit vorgeht, die Kürzungen im Bildungssektor zurücknimmt und das Problem der ellenlangen Wartelisten für Wohnungen angeht. Repression und das Schüren von Ängsten wird die Gesellschaft lediglich zeitweise lahmlegen können. Die Regierung begeht einen Fehler, wenn sie meint, dass eine Entwicklung hin zum Sicherheitsstaat diese sozialen Probleme wird lösen können. Die Revolutionen im Nahen Osten und in Nordafrika haben uns jüngst gelehrt, dass kein einziges Verbot eine solche Diskussion wird abwürgen können – wenn die Klassenfrage aufs Neue gestellt wird.