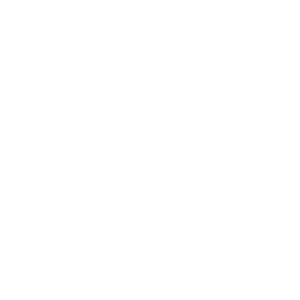Anti-demokratisches Abkommen zielt darauf ab, den Einfluss der Banken und Konzerne auf politische Entscheidungsprozesse weiter zu verstärken
Anti-demokratisches Abkommen zielt darauf ab, den Einfluss der Banken und Konzerne auf politische Entscheidungsprozesse weiter zu verstärken
von Vladimir Bortun, „Socialist Party“ (Schwesterorganisation der SAV und Sektion des CWI in England & Wales)
Zur Zeit sind die multinationalen Konzerne dabei, einen gewaltigen Schritt zu tun: Mit dem Abkommen namens „Transatlantic Trade and Investment Partnership“ (TTIP) versetzen sie der ohnehin schon begrenzten Demokratie aber auch den Grundrechten der Menschen einen schweren Schlag. Besondere Gefahren bringt dabei ein wesentlicher Bestandteil dieser „Partnerschaft“ mit sich: das sogenannte „investor-state dispute settlement“ (dt.: „Übereinkunft bei Streitigkeiten zwischen Investoren und Staaten“). Diese Vereinbarung manifestiert und verstärkt die Unterordnung des kapitalistischen Staates unter die Interessen der Unternehmen.
Weitgehend ohne Kenntnis der Allgemeinheit handelt es sich bei der TTIP um ein Handelsabkommen zwischen EU und den USA, das bereits seit Juli 2013 verhandelt wird. Nach offiziellen Angaben auf der Webseite der Europäischen Kommission „zielt [die TTIP] darauf ab, in einer ganzen Reihe von Branchen Handelsbarrieren abzubauen, um den Kauf und Verkauf von Waren und Dienstleistungen zwischen der EU und den USA zu erleichtern“. Genauer gesagt geht es in erster Linie darum, Hürden für Handel und Investitionen abzuschaffen sowie die technokratischen Regularien und Standards anzupassen. In einer „unabhängigen“ Untersuchung, die von der Europäischen Kommission in Auftrag gegeben wurde, wird behauptet, dass die TTIP der Wirtschaft in der EU jedes Jahr 119 Milliarden Euro, der US-Wirtschaft 95 Milliarden Euro und dem Rest der Welt noch einmal 100 Milliarden Euro einbringen wird.
Wie bereits erwähnt beinhaltet die TTIP auch einen sehr detailliert ausgearbeiteten Mechanismus, der als „investor-state dispute settlement“ (ISDS) bezeichnet wird. Ein von der Europäischen Kommission im November 2013 veröffentlichtes Arbeitspapier definiert das ISDS als System, das es „einem Investor erlaubt, sich mit einer Forderung an eine Behörde des jeweils gastgebenden Landes direkt an ein international besetztes Tribunal zu wenden“. Mit anderen Worten: Unternehmen haben damit das Recht, juristische Verfahren gegen Staaten zu eröffnen, und diese Klagen müssen dann von einer dritten Partei auf internationaler Ebene juristisch behandelt werden. Möglich soll dieses Vorgehen bereits sein, sobald Investoren behaupten, dass der jeweilige Staat ihnen eine der folgenden vier Arten von Absicherung nicht zugestanden hat: „1. Absicherung gegen Diskriminierung (Abkommen über die Bevorzugung und Behandlung von Staaten); 2. Absicherung gegen Enteignung, die nicht aus allgemeinpolitischen Gründen vollzogen und nicht korrekt entschädigt wird; 3. Absicherung gegen ungerechte und unangemessene Behandlung: z.B. Verweigerung grundlegender Gleichbehandlung den jeweiligen Prozessen; 4. Absicherung der Möglichkeit, Kapital transferieren zu können“.
Dabei werden diese vier Garantie-Erklärungen nicht näher erläutert. Es werden weder Kriterien genannt, auf deren Grundlage entschieden wird, wann ein Bruch einer dieser Garantien vorliegt, noch wird darüber hinaus spezifiziert, was Investoren überhaupt davon abhalten soll, unbegründete Verfahren gegen Staaten anzustrengen. Von daher sieht es so aus, als stünde es den Unternehmen frei, immer dann Klage gegen Staaten einzureichen, wann immer sie der Meinung sind, dass ihre Geschäftsinteressen durch die Gesetze oder politischen Beschlüsse eines einzelnen Landes beschränkt werden. Das Problem ist jedoch wesentlich umfassender.
Weil die Gerichte in den jeweiligen Ländern ja „negativ eingestellt oder nicht ausreichend unabhängig“ sein könnten (wie uns ein Dokument der Europäischen Kommission weismachen will), sollen Konflikte zwischen Unternehmen und Staaten von international und willkürlich zusammengesetzten Schiedsstellen bzw. durch „Instanzen“ geschlichtet werden, die in den letzten zwei Jahrzehnten immer mehr an Bedeutung gewonnen haben. Dabei scheint die Kommission sehr entscheidende Fragestellungen offen zu lassen: Wer sind diese Schlichter? Wodurch ist garantiert, dass diese Schiedsstellen unabhängig sind? Wem gegenüber sind diese rechenschaftspflichtig? Wer kann sie zur Verantwortung ziehen? Kurz: „Wer kontrolliert die Kontrolleure?“. Ganz offensichtlich niemand. Im Moment werden ISDS-Fälle von Gremien behandelt, die aus drei Personen bestehen. Diese fällen hinter verschlossenen Türen grundlegende Entscheidungen, die mit der Realität der Menschen, die am Ende davon betroffen sein werden, nicht viel zu tun haben. Und gegen die Urteile, die dort gefällt werden, kann kein Einspruch eingelegt werden. Eine Möglichkeit, in Berufung zu gehen, gibt es nicht.
Hinzu kommt, dass es sich bei diesen Schlichtern insgesamt um eine „kleine Gruppe elitärer Juristen“ handeln wird, die schon als „verschworene Gemeinschaft“ oder gar als „Schieds-Mafia“ beschrieben worden sind. Statistiken, die in einem Bericht von 2012 durch das „Corporate Europe Observatory“ und das „Transnational Institute“ vorgelegt wurden, scheinen diese Beschreibungen zu unterstützen: „Für alle Fälle, die vor dem >International Centre for Settlement of Investment Disputes< der Weltbank (ICSID) behandelt wurden, liegt der Anteil der Schlichter, die aus Westeuropa und Nordamerika stammen, bei 69 Prozent. Betrachtet man die Schlichter genauer, die an mehr als zehn Verfahren beteiligt waren, so kommt man sogar auf 83 Prozent“. Von allen 450 Konfliktfällen zwischen Unternehmen und Einzelstaaten, die seit 2012 bekannt sind, sind 55 Prozent von nur 15 verschiedenen Schlichtern behandelt worden.
Wenn auch nicht besonders überraschend, so wiegt dennoch schwerer, dass viele dieser Schlichter äußerst Konzern-freundlich ausgerichtet sind. Tatsächlich ist es so, dass es aufgrund fehlender Regelungen, was mögliche Interessenskonflikte angeht, nicht unüblich ist, so ein Bericht des „Democracy Center“ von 2013, dass einige dieser Schlichter „hin und her wechseln zwischen ihrer Rolle als [angeblich unparteiisches] Gremiumsmitglied im einen, zu Unternehmensanwälten im nächsten Fall. Viele üben sogar zeitgleich beide Rollen aus und agieren parallel als Berater von Unternehmen wie auch von Einzelstaaten“. Einige dieser Leute, die angeblich „weniger voreingenommen“ sein sollen als die Gerichte in den jeweiligen Ländern, sind tatsächlich „Vorstandsmitglieder großer multinationaler Konzerne gewesen, darunter jene, die Verfahren gegen Entwicklungsländer angestrengt haben“.
Das mag als Erklärung dafür dienen, weshalb nach Angaben eines UNO-Papiers im Jahr 2012 „in 70 Prozent der Fälle den Forderungen der Investoren entsprochen wurde, zumindest teilweise“. Selbst wenn sie gewinnen, kostet es die Staaten (bei denen es sich üblicher Weise um Entwicklungsländer handelt) Millionen, die sie für ihre Verteidigung bezahlen müssen. Nehmen wir das Beispiel El Salvador, von dem auch im Bericht des „Democracy Center“ die Rede ist:
„Ländliche Kommunen waren besorgt aufgrund der chemischen Verunreinigung der örtlichen Flüsse und Trinkwasserreservoirs mit Arsen, das aus einem kanadischen Goldabbauunternehmen [„Pacific Rim“] stammte. Obwohl ihnen riesige Steine in den Weg gelegt wurden und angesichts offensichtlicher Gefahr (drei AktivistInnen sind ermordet worden), haben es die Gemeinden von Las Cabañas erfolgreich vermocht, die Regierung von Salvador derart unter Druck zu setzen, dass diese es ablehnen musste, dem Bergwerk die nötigen Genehmigungen auszustellen. Alle Betroffenen sahen darin einen enormen Fortschritt, um im Land zu einer nachhaltigen Wasserversorgung zu kommen. Damit schienen die Wasserreserven des Landes auch für zukünftige Generationen gesichert zu sein. Das Recht auf sauberes Wasser war offenbar wichtiger als das Recht der Bergbaukonzerne, Profite zu machen.
In einer Art Racheakt zog „Pacific Rim“ allerdings vor Gericht und beschwerte sich darüber, dass die Weigerung der Regierung El Salvadors, dem Unternehmen die Genehmigungen zu erteilen das Recht des Konzerns verletze „gerecht und angemessen“ behandelt zu werden. Auf dieser Grundlage verklagt das Bergbauunternehmen gerade die Bevölkerung von Salvador auf 315 Millionen Dollar vor dem Handelsgericht der Weltbank. Der Konzern fordert Entschädigung für ausbleibende Profite. Unabhängig davon, ob eine Regierung den Prozess gewinnt oder nicht, muss sie Millionenbeträge für ihre Verteidigung ausgeben. Geld, das in einem Land, in dem 42,5 Prozent der Bevölkerung unterhalb der Armutsgrenze leben, ansonsten für LehrerInnen und ÄrztInnen ausgegeben werden könnte. Wenn das Schiedsgericht ein Urteil fällt, das im Sinne der jeweiligen Konzerne ist (was 2012 auf 70 Prozent der Fälle zutraf), können sich die Summen, die aus den öffentlichen Haushalten abgezogen werden müssen, leicht auf zehn oder gar hundert Millionen Dollar belaufen. Im vorliegenden Fall gehen diese Summen am Ende dann an ein Bergbauunternehmen in Kanada und ein paar ohnehin schon gut situierte Anwaltskanzleien, die sich auf Unternehmensrecht spezialisiert haben.
Der „Fall El Salvador“ ist nur einer von hunderten, in denen Unternehmen auf der ganzen Welt gegen einzelne Regierungen vor Gericht gezogen sind.
Andere bekannte Beispiele sind „Bechtel“ gegen Bolivien, „Chemtura“ gegen Kanada, „Cargill“ gegen Mexiko oder „Phillip Morris“ gegen Uruguay. Einige dieser Verfahren wurden überhaupt erst möglich, weil man sich auf Vorgaben aus dem ISDS bezog, wozu auch das berüchtigte „North American Free Trade Agreement“ (NAFTA; dt.: „Nordamerikanisches Freihandelsabkommen“) gehört. Weil auch die künftige TTIP – wie oben dargelegt – ganz ähnliche Regelungen beinhaltet, scheint es nur eine Frage der Zeit zu sein, dass es auch zwischen US-amerikanischen Konzernen und europäischen Staaten (oder umgekehrt) zu derartigen juristischen Verfahren kommen wird.
Die Privatisierung des internationalen Rechts, zu der die TTIP führen würde und die erneut den grundlegend neoliberalen Charakter der EU unterstreicht, wäre für die letzten Reste nationalstaatlicher Souveränität, die in Europa noch auszumachen sind, ein schwerer Schlag. Juan Fernández-Armesto, ein Schlichter, der aus Spanien kommt, fasst das Problem andeutungsweise wie folgt zusammen: „Wenn ich nachts aufwache und über die Tätigkeit als Schlichter bei der Schiedsstelle nachdenke, lässt die Überraschung darüber nicht nach, dass souveräne Staaten überhaupt einer Schlichtung zum Thema Investitionen zugestimmt haben […] Drei einzelne Privatpersonen werden mit der Macht ausgestattet, ohne jede Rechenschaftsverpflichtung oder nur die Möglichkeit, Einspruch dagegen einlegen zu können, sämtliche Handlungen der Regierungen, alle Gerichtsurteile sowie die bestehenden Gesetze und Erlasse, die in den Parlamenten beschlossen wurden, überprüfen zu können“. Aufgrund dieser düsteren Aussichten, sollte es für SozialistInnen überall auf der Welt ganz klar sein, dass diese „Übereinkunft“ namens TTIP verhindert werden muss.
Obgleich der kapitalistische Staat ohnehin prinzipiell nach den Interessen der Konzerne und Unternehmen ausgerichtet ist, trachtet man mit derartigen juristischen „Reformen“ danach, auch die beschränktesten möglichen Reformvorhaben der Regierungen, die aufgrund des Drucks der Arbeiterklasse im Sinne einer sozialeren Gesellschaft zustande kommen könnten, für rechtswidrig zu erklären. Wenn dieses juristische Machwerk Wirklichkeit wird, werden die von der Linken Europas versprochenen Reformen und sogar jene, die auch nur von reformistischen VertreterInnen der Linken oder der Gewerkschaftsbewegung verfolgt werden, plötzlich zu illegalen Aktionen. Damit wäre es Schlichtern, die im Sinne der Banken und Konzerne entscheiden, auf einmal möglich, selbst das kleinste Reförmchen mit einem Handstreich in den Papierkorb zu befördern. Die Diktatur der Konzerne und des Profits kann freilich nur dann nachhaltig bekämpft werden, wenn man Widerstand gegen dieses Abkommen organisiert und eine sozialistische Alternative aufbaut, die den Reichtum im Allgemeinen und die Großkonzerne im Besonderen in öffentliches Eigentum überführt und sie der demokratischen Kontrolle und Verwaltung unterstellt.