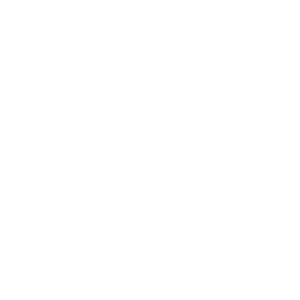Der Wettbewerb der nordatlantischen Staaten um die schlechtesten Lebens- und Arbeitsbedingungen
Vorbemerkung: Dieser Artikel des irischen sozialistischen Europaparlamentariers Paul Murphy wurde schon im April 2013 verfasst und verarbeitet deshalb nicht die jüngsten Entwicklungen. Seine Darstellung des Charakters und der Folgen des geplanten Freihandelsabkommens zwischen der EU und den USA ist aber absolut gültig.
Die bürgerliche Presse hat eine Menge an Druckerschwärze darauf verwendet, den Stellenwert des Abkommens zwischen der EU und den USA in den Himmel zu loben. So sei es darüber angeblich möglich, die beiden Wirtschaftsräume aus der Krise zu holen, in der sie zur Zeit stecken. Richard Bruton übertraf sich selbst in der „Sunday Business Post“ vom 14. April 2013, wo er behauptete, dass „allein die Abschaffung von Reglementierungen im EU-Dienstleistungssektor das Bruttoinlandsprodukt der EU um 2,6 Prozent“ steigen lassen würde. Drei Tage später stellt er in einer Presseerklärung fest, dass das ganze Abkommen das Bruttoinlandsprodukt (BIP) der EU um nicht mehr als 0,5 Prozent heben wird! (vgl.: http://www.eu2013.ie/news/news-items/20130416pre-tradeinformalpr/) Nach der Erfahrung mit den Versprechungen im Zusammenhang mit dem „Lissabon Vertrag“ sollten diese Thesen über Wachstumsschübe und hunderttausende Arbeitsplätze, die dadurch angeblich neu entstehen, natürlich nicht für bare Münze genommen werden.
Von Paul Murphy, Mitglied des Europaparlaments für die Socialist Party Irland
Die Verhandlungen sind geheim und finden fernab von jeder Öffentlichkeit oder einer parlamentarischen Kontrolle statt. Wir können von Glück sagen, dass das von der Europäischen Kommission für den Europarat angefertigte Entwurf-Papier der Öffentlichkeit zugespielt worden ist, obwohl man peinlichst darauf bedacht war, es jeder/m Europaabgeordneten und natürlich der Allgemeinheit vorzuenthalten. Dieser Entwurf zeigt ganz deutlich, dass es bei den Verhandlungen um die Interessen der Konzerne geht. Eine besondere Rolle spielen die Agrar-Unternehmen auf beiden Seiten des Atlantik. Ihre Interessen sollen auf Kosten der arbeitenden Menschen sowohl in Europa als auch in den USA durchgesetzt werden. Es soll um die völlige Liberalisierung der öffentlichen Dienste gehen und um einen Wettlauf, wer die Regulierungsstandards am weitesten herunterzuschrauben vermag. Das Vorhaben lautet: privilegierter Zugang für die Großkonzerne auf Daten der Justizressorts. Im Internet-Zeitalter kann das zur Gefahr für die Bürgerrechte werden und dazu führen, dass das ACTA-Abkommen doch noch durch die Hintertür eingeführt wird! (vgl.: http://www.paulmurphymep.eu/acta-u-s-sopa-and-pira-defeated)
Worthülsen von EU und USA
Die Europäische Kommission wie auch der Europarat unter Vorsitz des irischen Premiers sind ganz außer sich und voll des Enthusiasmus. Seit dem Scheitern eines ähnlichen Abkommens Anfang der 1990er Jahre hegten die führenden PolitikerInnen Europas lange schon den Wunsch nach einem Freihandelsabkommen mit den USA. Dabei dachten sie nicht allein an die Folgen, die das für die Wirtschaft haben würde. Es war damit auch die Hoffnung verbunden, dass ein Abkommen ein politisches Signal mit sich bringen würde, das über die unmittelbaren Effekte für den Handel hinausgeht. Die Hoffnung besteht darin, dass das Abkommen auch dazu führen wird, die USA zu einer Rückbesinnung auf ihre traditionellen politischen Partner zu bringen und auf diese Weise dem zunehmenden Einfluss der Wachstumsmärkte (vor allem Chinas) auf politischer und ökonomischer Ebene entgegenwirken zu können.
In seiner Rede zur Lage der Nation vom 13. Februar kündigte der US-Präsident Barack Obama an, dass „wir Gespräche über den gemeinsamen transatlantischen Handel und eine Investitionspartnerschaft mit der Europäischen Union aufnehmen werden, weil ein Handel, der über den Atlantik hinweg frei und fair abläuft, Millionen gut bezahlter amerikanischer Arbeitsplätze sichern wird“.
Sowohl die von der Rezession gebeutelte EU als auch die USA verbinden damit die Hoffnung, dass ihnen dieses Abkommen helfen wird, den Weg aus der Krise zu finden. So kündigte Präsident Obama im Jahr 2010 beispielsweise an, dass er die US-amerikanischen Exporte bis Ende 2015 verdoppeln will. Karel De Gucht, Handelskommissar der EU und erzkonservativer Vertreter der neoliberalen Lehre, meint, dass solch ein Abkommen „das kostengünstigste Konjunkturprogramm [ist], das man sich nur vorstellen kann“.
Die Europäische Kommission wird niemals müde zu wiederholen, dass es der Außenhandel ist, der Europa davor bewahrt hat, in eine vollends ausweglose Situation zu geraten. Einige Stimmen in der Kommission gehen davon aus, dass es die Krise ist, die die Wahrscheinlichkeit des Zustandekommens eines solchen Abkommens vergrößert. In einem Interview mit „EUbusiness“ ergänzte De Gucht:
„ […] für Europa sollten die positiven Effekte dieses Abkommens, das wir zu erreichen versuchen, auf der Einnahmeseite zwischen 0,5 Prozent und 1,0 Prozent des BIP liegen. Das bedeutet hunderttausende neuer Arbeitsplätze […] Unsere Produzenten bekommen neue Abnehmer, billigere Komponenten für unsere Produkte und ein Mehr an Wettbewerb, um alle unsere Unternehmen noch effizienter werden zu lassen.“
Einige WirtschaftswissenschaftlerInnen werden derzeit damit zitiert, dass solch ein Abkommen, das zur größten Freihandelszone der Welt führen würde, für beinahe 50 Prozent des globalen BIP und ein Drittel des weltweiten Handelsaufkommens stehe. Das könnte zwei Millionen Arbeitsplätze mit sich bringen und den Handel zwischen der EU und den USA ankurbeln. Die Rede ist von einem Umfang in Höhe von über 120 Milliarden US-Dollar binnen fünf Jahren. Sollte dies tatsächlich der Fall sein, dann würde diese Nachricht ganz eindeutig auf beiden Seiten des Atlantik mit Freuden aufgenommen werden. Schließlich sind die Arbeitslosenzahlen hoch und in Folge eines niedrigen, stagnierenden oder gar zurückgehenden Wirtschaftswachstums gehen weiterhin Arbeitsplätze verloren. Verstärkt wird dies durch die niedrige Nachfrage in Folge der in ganz Europa durchgeführten, brutalen Austeritätspolitik.
Seit 2008, als die Krise ihren Anfang nahm, sind in der Eurozone und den USA rund 15 Millionen Arbeitsplätze verloren gegangen. Allein deshalb versuchen die PolitikerInnen jede Möglichkeit zu erhaschen, auch mal mit einer „guten Nachricht auftrumpfen“ zu können. Schließlich merken auch sie, dass die Unzufriedenheit größer wird und der Widerstand der Menschen gegen ihre unbeliebte Politik, die die Zukunftsperspektiven und Lebensumstände von Millionen von ArbeiterInnen und jungen Leuten zunichte macht, stärker wird.
Doch abgesehen davon wäre die Welt eine schönere, bessere und vor allem wohlhabendere, wenn es tatsächlich zu all den Errungenschaften kommen würde, die solche Handelsabkommen ja immer mit sich bringen sollen! So war beispielsweise im Zusammenhang mit dem nordamerikanischen Freihandelsabkommen NAFTA versprochen worden, dass in den USA Millionen neuer Arbeitsplätze entstehen würden. Eine kürzlich veröffentlichte Studie ist jedoch zu dem Schluss gekommen, dass umgekehrt Arbeitsplätze verloren gegangen sind. (vgl.: http://www.epi.org/publication/heading_south_u-s-mexico_trade_and_job_displacement_after_nafta1/) Was das angeht, ist also zu größter Skepsis zu raten.
„Keine tiefhängenden Früchte“
Am 3. März zitierte die „Financial Times“ den Sprecher der „Demokraten“ im US-Finanzausschuss, Max Baucus: „Es geht um ein Abkommen, das einfach geschlossen werden muss. Das muss jetzt geschehen und es muss vernünftig gemacht werden“.
Allerdings geben beide Seiten zu, dass die Verhandlungen trotz der allgemeinen Freude über dieses Abkommen hart werden und ein „positives“ Ergebnis keineswegs gesichert ist. Bisher geht das Engagement beider Seiten in den Gesprächen nicht viel weiter, als dass man sich formell zum Freihandel bekennt und den Protektionismus ablehnt, der aufgrund der Krise zunimmt. Beide Seiten sind für ihre aggressive Handelspolitik bekannt, mit der die heimische Industrie und die jeweiligen Großkonzerne geschützt werden sollen. Aus diesem Grund strebt man danach, das Abkommen so offen wie möglich zu gestalten, um genug Spielraum für Zugeständnisse zu haben.
Es sind eine Reihe von Schwerpunkten formuliert worden, die als gemeinsame Ziele gelten. Dazu gehört die Aufhebung von Zöllen, eine weitere Liberalisierung des Dienstleistungssektors und Zugang zu den jeweiligen öffentlichen Aufträgen. Das bedeutet auch, dass im Bereich der öffentlichen Dienste weiter liberalisiert und privatisiert wird, weil multinationale Konzerne im Wettbewerb um Angebote öffentlicher Auftraggeber stehen. Des weiteren hervorzuheben sind die Bereiche der sogenannten „Intellectual Property Rights“ (IPR; dt.: Recht auf geistiges Eigentum), regulatorische Maßnahmen und die Aufhebung der zollfremden Handelshemmnisse. Zu diesem Feld der zollfremden Handelshemmnisse gehört auch das Ziel der „Harmonisierung“ von Standards über Regulierungsmaßnahmen. Das tangiert z.B. den Gesundheitsbereich aber auch den Gesundheits- und Verbraucherschutz, was vor allem in Bezug auf den Agrarhandel und Lebensmittelmarkt von Bedeutung ist. Dahinter steht, dass Kosten gespart werden sollen.
Hinzu kommt, dass es wahrscheinlich Versuche geben wird, Investitionen in besonderem Maße zu fördern. Auf diese Weise wird Konzernen, die in einem der beiden Märkte investieren, die Möglichkeit besonderer Rechte eingeräumt.
Wenn es um die Aufhebung der Zölle geht, so wird man in diesem Punkt vielleicht am weitesten gehen, da die Zollregelungen ja schon vergleichsweise kommod sind. Für Fertigprodukte, die aus der EU kommen und auf dem US-amerikanischen Markt landen, werden 3,5 Prozent erhoben, und Waren und Güter werden mit 5,2 Prozent bedacht. Es wird gesagt, dass der Abbau von Zollbarrieren vor allem der krisengeschüttelten Autoindustrie zugute kommen würde, weil die Zollregelungen in diesem Bereich immer noch über dem Durchschnitt liegen. Von der Aufhebung der Zölle wird der Handel innerhalb der jeweiligen Industriezweige oder der Handel zwischen den Konzernen am meisten profitieren, weil ein wesentlicher Teil des transatlantischen Handels aus diesem Bereich besteht (vgl.: Seite 3 des IFO-Berichts → http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/Publikationen/Studien/dimensionen-auswirkungen-freihandelsabkommens-zwischen-eu-usa-summary,property=pdf,bereich=bmwi2012,sprache=de,rwb=true.pdf).
Angaben des in München ansässigen IfO-Instituts zufolge speisen sich 61 Prozent der US-Importe aus EU-Subventionen für US-amerikanische Konzerne, und 31 Prozent der US-Ausfuhren in die EU würden als Handel gerechnet, der innerhalb der jeweiligen Industriezweige abläuft. Die Europäische Kommission behauptet, dass eine Aufhebung der Zollschranken für die VerbraucherInnen zu sinkenden Preisen führen würde. Am wahrscheinlichsten ist aber, dass dadurch die Profite der Unternehmen steigen werden, die auf beiden Seiten des Atlantik operieren.
Liberalisierung des öffentlichen Dienstes
Das größte Interesse der europäischen Konzerne besteht darin, dieses Abkommen nutzen zu können, um zu einer weiteren Liberalisierung des öffentlichen Sektors zu gelangen und einer Reform des Marktes für öffentliche Auftragsvergabe. Schließlich ist das der Hebel, mit dem öffentliche Dienstleistungen und Aufgaben an private Anbieter übergehen können. Dabei haben sie vor allem den Anspruch des „Buy American“ (dt.: „Kauft amerikanische Waren“) im Blick, der auf bundesstaatlicher Ebene vertreten wird. Das Entwurf-Papier sagt ausdrücklich, dass „das Ziel der Verhandlungen über den Handel mit Dienstleistungen darin bestehen wird, den Ist-Zustand mit einem individuell unterschiedlichen Ausmaß an Liberalisierung auf das höchste Maß heraufzuschreiben, dass bisher in Freihandelsabkommen festgeschrieben ist. Desgleichen soll versucht werden, neue Zugänge zu Märkten zu schaffen, indem die verbliebenen und lange bestehenden Marktbeschränkungen angegangen werden […]“. Dies ist die Art von Fachjargon, die riesige europäische Konzerne wie z.B. „Veolia“ in Verzückung versetzt.
Agrargeschäfte der USA und genetisch veränderte Lebensmittel
Einer der sensibelsten Punkte in den Verhandlungen wird die Landwirtschaft sein, da sowohl die EU als auch die USA nicht nur auf einen geschützten und starken Agrarbereich verweisen können sondern auch verschiedene Standards haben, wenn es um den Gesundheitsschutz geht.
Michael Froman, Obamas Berater im internationalen Wirtschaftsrat, hat die Landwirtschaft als „den Koloss, der im Raum steht“ beschrieben. Unter den politischen Parteien in den USA scheint Einigkeit darüber zu bestehen, dass ein Abkommen, mit dem der europäische Markt nicht für US-amerikanische Agrarprodukte geöffnet wird, eine Totgeburt wäre.
Max Baucus, Sprecher des Finanzausschusses im US-Senat, dazu: „Ein bedeutender Teil eines jeden letztlich zustande kommenden Abkommens wird die Aufhebung der Zollschranken sein. Aber der Kongress wird nicht für ein Abkommen stimmen, das es nicht vermag, die Felder anzugehen, die wahrscheinlich einige der bedeutsamsten wirtschaftlichen Ziele mit sich bringen. Dabei meinen wir in erster Linie die Aufhebung der Zollbarrieren im Bereich des Agrarhandels und dass sichergestellt ist, die regulatorischen Prozesse anzupassen und herunterzufahren.“
Diese Wortwahl hat die Verbraucherschutzorganisationen in Europa sofort in Alarmbereitschaft versetzt, weil darin der Euphemismus für die Erlaubnis enthalten ist, genetisch veränderte Lebensmittel und andere, strengen Auflagen unterliegende Produkte auf den Markt zu bringen. In den USA sind die Auflagen für genetisch veränderte Lebensmittel z.Zt. wesentlich laxer als in Europa. Verbraucherschutzorganisationen sind besorgt, dass durch eine Abschwächung der Regularien und Standards viel mehr genetisch veränderte Lebensmittel auf den europäischen Markt kommen könnten. Dasselbe gilt für hormonbehandeltes Rind- und mit Chlor sterilisiertes Hähnchenfleisch. Angesichts der Erfahrung mit dem jüngsten Skandal um das Pferdefleisch in Europa sollte klar sein, dass eine Absenkung der Standards nur im Interesse der Agrarkonzerne ist und das genaue Gegenteil von dem darstellt, was eigentlich nötig wäre.
Da stellt sich die Frage, ob es sich hierbei um eines der „Zugeständnisse“ handelt, von denen Karel De Gucht gesprochen hat, als er sich zu den Verhandlungen äußerte. Werden die Dienstleistungsunternehmen aus der EU ein für sie besseres Freihandelsabkommen erreichen und leichteren Zugang zum US-Markt bekommen, wenn als Gegenleistung dafür hormonbehandeltes Rindfleisch auf den EU-Markt gelangt?
Es gibt aber noch eine Reihe anderer Themen, die von Bedeutung sind. Weil die Gefahr bestand, dass das ACTA (Anti-Produktpiraterie-Handelsabkommen) für die Freiheiten im Internet den Tod bedeutet hätte, ist es im Sommer letzten Jahres zu Massenprotesten gegen dieses Abkommen gekommen. Das hat zu der als historisch zu bezeichnenden Tatsache geführt, dass die Europäische Kommission zurückrudern musste. Die USA haben ACTA allerdings unterschrieben, und es gelten dort viel repressivere Gesetze zum „Schutz des geistigen Eigentums“. Von daher könnte ACTA durch die Hintertür wieder zum Thema werden. Dasselbe gilt für den Datenschutz.
Widerstand der Gewerkschaften – Arbeitnehmerrechte in Gefahr
Der Europäische Gewerkschaftsbund (EGB) hat angekündigt, dass er mit dem US-amerikanischen Dachverband der Gewerkschaften, der AFL-CIO, zu einer gemeinsamen Position kommen will. In ersten Verlautbarungen haben sich beide Organisationen in ihrer Bewertung der möglichen Folgen eines Abkommens zwischen EU und USA sehr zurückhaltend geäußert. Allerdings waren sie nicht dazu in der Lage, Opposition zu dem Abkommen zu beziehen.
Ein Grund, weshalb die Gewerkschaften das Abkommen nicht grundsätzlich ablehnen, scheint darin zu bestehen, dass sie glauben, die Gefahr, dass Arbeitnehmerrechte beschnitten werden könnten, sei gering, wenn zwischen zwei entwickelten Wirtschaftsräumen mit vergleichsweise hohen Umwelt- und Sozialstandards (im Verhältnis zur Situation in den Entwicklungsländern) eine Übereinkunft getroffen wird. Die AFL-CIO erklärt dazu, dass „im Gegensatz zum Handel mit vielen anderen Regionen der verstärkte Handel mit der EU die Möglichkeit eröffnet, mit Staaten in Austausch zu treten, die größtenteils eine aktive Arbeitsmarktpolitik betreiben und starke soziale Sicherheitsnetze vorweisen […]. Verstärkte Handelsbeziehungen mit der EU könnten vorteilhaft sein“. Die auf EU-Fragen spezialisierte Zeitung „European Voice“ beschreibt das als „größte Stärkung der amerikanischen Arbeitnehmerrechte durch ein Handelsabkommen in der Neuzeit“.
Doch das ist nicht nur eine viel zu optimistische Einschätzung über die in Europa herrschenden gewerkschaftlichen und Arbeitnehmerrechte, die im Zuge der sich zuspitzenden Krise unter schwerem Beschuss stehen. Es wird damit auch die Illusion genährt, dass ein Handelsabkommen zwischen der EU und den USA zur Verbesserung der Umwelt- und Sozialstandards führen würde. Im Zusammenhang mit den jetzigen Verhandlungen um ein gemeinsames Abkommen wird das aber nicht geschehen. Schließlich dominieren die Interessen der Großkonzerne. Und diese sind mit den Interessen der Arbeiterklasse nicht in Einklang zu bringen. Wenn man sich noch einmal vergegenwärtigt, wie die US-Administration sich geweigert hat, dem „Kyoto Protokoll“ beizutreten – bei dem es sich um das einzige, wenn auch vollkommen unzureichende Abkommen über die Verringerung schädlicher Emissionen handelt –, wird klar, dass Umweltbelange nicht gerade an erster Stelle der Tagesordnung stehen werden.
ArbeitnehmervertreterInnen werden keine Gelegenheit haben, mit am runden Tisch zu sitzen, um die Bedingungen und die Tragweite eines solchen Abkommens zu beschließen und dafür zu sorgen, dass die abhängig Beschäftigten sowohl in der EU als auch den USA von diesem Abkommen profitieren könnten. Es ist aber viel eher wahrscheinlich, dass dieses Abkommen dazu dienen soll, einen Wettbewerb um die niedrigsten Löhne und schlechtesten Arbeitsbedingungen einzuläuten. Das wird ein gegen die gewerkschaftlichen und Arbeitnehmerrechte geführter Rachefeldzug im Namen der Wettbewerbsfähigkeit und des freien Handels. Auf beiden Seiten des Atlantik sollten die Gewerkschaften klar in Opposition gehen zu diesen Verhandlungen, in denen sie nicht einmal gehört werden.
Es ist wahr, dass die AFL-CIO den Verhandlungen keinen Blankoscheck ausgestellt hat. Sie erklären, dass „kein Abkommen zwischen der EU und den USA dafür benutzt werden darf, Deregulierung zu betreiben oder die jeweils höheren Standards herunterzufahren“. Soweit so gut. Um aber der bestehenden Gefahr vorzubeugen, dass dies doch geschieht, reicht es einfach nicht aus, „die Verhandlungen zwischen der EU und den USA genau zu verfolgen“. Dazu bedarf es der aktiv ausgeübten Opposition vor Beginn der Verhandlungen und während des gesamten Zeitraums, in der sie stattfinden.
Der EGB wie auch die AFL-CIO haben eine Reihe von wichtigen und sehr konkreten Aspekten aufgeworfen und Kritik an ihnen geübt, was auf die Fallen hindeutet, die ein solches Abkommen für die Menschen aus der Arbeiterklasse in sich birgt. So hat der EGB z.B. darauf hingewiesen, dass die USA die Konventionen der an die UNO angegliederten „Internationalen Arbeits-Organisation“ (ILO) über die Koalitionsfreiheit und gewerkschaftliche Tätigkeitsbereiche nicht ratifiziert hat. Dieser Umstand – da liegt der EGB richtig – führt dazu, dass die in der EU beheimateten multinationalen Konzerne begierig auf die US-Bundesstaaten schielen, in den der Grundsatz „right to work“ gilt (gemeint ist damit, dass das Recht besteht, Streiks zu brechen).
Privilegierter Zugang für die Großkonzerne auf Daten der Justizressorts
Ein weiterer und extrem bedeutender Punkt, der von den beiden Gewerkschaftsdachverbänden in nur sehr begrenztem Maße thematisiert wird, ist die Einbeziehung eines „Mechanismus zur Klärung von Angelegenheiten zwischen Unternehmen und staatlichen Instanzen“ in ein mögliches gemeinsames Abkommen. In dem o.g. und ungewollt an die Öffentlichkeit gelangten Entwurf-Papier der Europäischen Kommission wird dies als Ziel beschrieben.
Dabei geht es um einen Schutzmechanismus für Investitionen, der im Interesse der privaten Kapitalanleger funktioniert und die Möglichkeiten des Staates beschränkt, auf diesem Gebiet etwaige Maßnahmen zu ergreifen. Wenn beispielsweise ein Staat irgendeine Maßnahme ergreift, durch die die Profitabilität eines Unternehmens tangiert wird – zu denken wäre da an die Einführung bewährter Arbeits- oder Umweltschutzrichtlinien oder die Verstaatlichung ausländischer Konzerne –, dann hätte der betroffene Konzern die Möglichkeit, den Staat für Gewinnausfälle außerhalb des regulären Rechtssystems zu verklagen. Was dabei dann rauskommen mag, kann man derzeit in Kanada beobachten. Dort zeigte das bereits erwähnte NAFTA schon seine entsprechende Wirkung. Momentan sind Verfahren gegen den Staat Kanada anhängig, in denen es um eine Summe von insgesamt 2,5 Milliarden US-Dollar geht. Die Forderungen basieren auf Fällen, in denen Konzerne Klage gegen den Staat erhoben haben. In der Provinz Quebec geht es in einem Fall auch um Verluste aufgrund der Einführung eines Moratoriums zum Thema Fracking. (vgl.: http://www.huffingtonpost.ca/maude-barlow/transatlantic-free-trade_b_2903028.html)
Mangelnde Transparenz bei den Verhandlungen
Das Streben nach einem unternehmensfreundlichen Inhalt zeigt sich auch im Prozess, der den eigentlichen Verhandlungen vorausging. Beim Treffen des „Civil Society Dialogue“ im Jahr 2010 – also kurz nachdem er zum EU-Kommissar für internationalen Handel berufen wurde – erklärte Karel De Gucht: „Meine Arbeitsplatzbeschreibung lautet, für die europäische Industrie und den europäischen Dienstleistungssektor neue Märkte zu eröffnen“. (vgl.: Seite 10 des „Corporate Europe Observatory Report“ → http://corporateeurope.org/sites/default/files/publications/trade_invaders_0.pdf)
Von daher ist es keine Überraschung, dass Lobby-Organisationen der Unternehmen und Konzerne wie etwa „Business Europe“ direkten Einfluss nehmen und der EU die Handelsziele diktieren. Laut „Corporate Europe Observatory“, einer Nichtregierungsorganisation mit Sitz in Brüssel, sieht es folgendermaßen aus:
„Business Europe“(BE) setzt sich aus 41 nationalen Arbeitgeber- und Industrieverbänden zusammen und spielt eigenen Angaben zufolge eine „entscheidende Rolle“ um sicherzustellen, dass [die Interessen der] Unternehmen vis-à-vis mit den Einrichtungen der EU berücksichtigt und verteidigt werden. Das prinzipielle Ziel ist dabei, die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen zu erhalten und zu fördern. Auch wenn es sich bei BE um eine breit aufgestellte Allianz von europäischen Wirtschaftsunternehmen handelt, so offenbart ihre interne Struktur, dass diese Vereinigung von den Interessen der multinationalen Konzerne dominiert wird. Der Berater- und Unterstützer-Stab, der aus 60 VertreterInnen multinationaler Konzerne besteht, spielt nicht nur innerhalb der BE eine wichtige Rolle sondern auch dabei, den Kontakt von BE mit hochrangigen EU-Beamten herzustellen und aufrecht zu erhalten. (BE ist eine der mächtigsten Lobby-Organisationen auf EU-Ebene und daher eine der wichtigsten Gruppierungen mit Kontakt zur EU-Kommission.) Weil sie privilegierten Zugang zur Europäischen Kommission hat, ist sie gut aufgestellt um sicherzustellen, dass im Politbetrieb der EU die Konzerninteressen gründlich vertreten werden.“ (vgl.: http://corporateeurope.org/publications/businesseurope-and-economic-governance)
Der EGB erklärt demgegenüber in einem Online-Artikel zum Thema Welthandel, dass er „und die AFL-CIO, die die Debatte zwischen den beiden Verhandlungspartnern über Arbeitnehmerfragen ja de facto erst möglich machen, nur wenig Einfluss nehmen konnten, um den Transatlantic Economic Council zu beraten. Im Falle des Transatlantic Business Dialogue lief das ganz anders ab“.
Der enge Kontakt zwischen BE und Europäischer Kommission bedeutet, dass erstere wesentlich mehr Macht hat, um Einfluss zu üben und das Verhandlungsmandat für besagte Handelsabkommen zu bestimmen. Diese Vereinigung wird vor und nach jeder Verhandlungsrunde sehr häufig konsultiert und um Stellungnahme gebeten. Die Strategie wird ihren Bedürfnissen angepasst. Dass sie Zugang zu Informationen haben, ist ein Privileg, von dem selbst die gewählten ParlamentarierInnen nur träumen können. Bestimmte Europaabgeordnete haben den Entwurf für das Verhandlungsmandat zwar zu Gesicht bekommen. Diese Dokumente sind aber mit dem Vermerk „begrenzter Zugang“ klassifiziert und ihr Inhalt darf nicht an die breitere Öffentlichkeit gelangen. In Treffen zwischen der Europäischen Kommission mit Mitgliedern des Europaparlaments im Zuge der Verhandlungen erhalten die Europaabgeordneten nur einen Bruchteil an Informationen über die Inhalte, die besprochen wurden. Und am Ende des Prozesses besteht alles, was sie tun können, darin, für oder gegen das Machwerk zu stimmen. Der Inhalt des Vertrags kann dann nicht mehr durch parlamentarische Abläufe (Beratungen in Ausschüssen etc.) geändert werden.
Die nächsten Schritte
Die Europäische Kommission hat sich auf einen Entwurf für ein Verhandlungsmandat geeinigt und diesen an den Europäischen Rat übermittelt. Nun ist es am Europarat, dieses Mandat zu diskutieren und darüber zu befinden. Da es sich beim Europarat ganz offensichtlich auch nicht um eine familiäre Einheit handelt, ist es möglich, dass verschiedene Mitgliedsstaaten – auch wenn sie der Idee eines Handelsabkommens grundsätzlich zustimmen – die Schwerpunkte verschieben und die Tragweite dieses Mandats anders bewertet sehen wollen. Das liegt an den unterschiedlichen marktwirtschaftlichen Interessen der jeweiligen Mitgliedsstaaten und ist eine Folge der verschiedenen Schwerpunktsetzung. Die Frage, welche Wirtschaftsbranchen komplett liberalisiert werden sollen, wird unterschiedlich beantwortet.
Die französische Regierung hat beispielsweise schon angedeutet, dass sie auf dem Recht der „kulturellen Besonderheiten“ besteht. Dabei geht es um einen Mechanismus, der es der französischen Regierung erlaubt, die Anzahl der in Frankreich ausgestrahlten ausländischen Radio- und Fernsehprogramme festzulegen. Auch wird damit sichergestellt, dass die französische Filmbranche durch Subventionen abgesichert ist. Beim ersten Versuch der Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen haben die USA im Sinne von Hollywood versucht, den Punkt der „kulturellen Besonderheiten“ in Frage zu stellen. Es sieht unter dem Strich alles danach aus, dass es im Europarat zwar bisweilen harte Auseinandersetzungen gegen mag, am Ende aber ein Mandat akzeptiert wird, das es der Kommission dann erlaubt, mit den USA in die Verhandlungen zu gehen.
Die irische Ratspräsidentschaft ist aufgrund der Möglichkeit eines Abkommens und der Hoffnung, das diese beginnen, noch bevor der Staffelstab am 1. Juli an die Regierung Litauens übergeht, geradezu verzückt. Wenn es so ablaufen wird, wie sie es sich wünschen, dann werden sie es ziemlich sicher so aussehen lassen, als sei dies ein wichtiger Beitrag für ihre Agenda mit dem Titel „Arbeitsplätze, Stabilität und Wachstum“. Unter dieses Motto haben sie schließlich ihre sechsmonatige Ratspräsidentschaft gestellt. Als die Idee eines gemeinsamen Handelsabkommens zum ersten Mal formuliert wurde, hegte man die Hoffnung, dass alles innerhalb von zwei Jahren über die Bühne gehen würde. Das scheint eine utopische Vorstellung zu sein. Mit Kanada verhandelt die Europäische Kommission schon seit 2009 und mit Indien seit 2007. Im Falle Kanadas laufen die Gespräche immer noch und das Abkommen mit Indien wird wahrscheinlich nie zustande kommen. Auf der Ebene der internationalen Beziehungen und Entwicklungen kann sich – sowohl in wirtschaftlicher als auch politischer Hinsicht – immer noch einiges so sehr verändern, dass das ganze Projekt am Ende noch komplett in Frage gestellt wird.
Welches Modell für gemeinsamen Handel?
Wenn SozialistInnen und die Linke allgemein Kritik an Freihandelsabkommen üben, wird ihnen allzu oft vorgeworfen, sie seien „gegen den Handel“. Aber stimmt das? Ist die Linke gegen ein Abkommen, das möglicherweise zwei Millionen Arbeitsplätze schaffen kann? Ist es wahr, dass die Linke grundsätzlich gegen den Handel eingestellt ist, obwohl es sich dabei nach Angaben des EU-Handelskommissars um „einen unentbehrlichen Bestandteil der Prosperität handelt“?
Schluss mit diesem Mythos! – Auch wenn es ganz unterschiedliche Modelle dazu gibt, sind wir nicht gegen den Handel an sich. Das derzeitige, kapitalistische und neoliberale Modell von Handel orientiert sich an den Interessen der Großkonzerne, und die darin enthaltenen „Regeln“ werden überall auf der Welt von den riesigen multinationalen Konzernen und den Regierungen festgelegt und dominiert, um in ihrem Interesse zu wirken. Angaben der UNCTAD (Konferenz über Handel und Entwicklung bei der UNO) zufolge sind „gut 80 Prozent des Welthandels von der Wertschöpfungskette geprägt, die auf transnationale Konzerne zurückgeht“. Die Globalisierung hat zu einer noch vernetzteren Weltwirtschaft und noch stärkerer Arbeitsteilung geführt. Das ist beispiellos in der Geschichte.
Auf der Grundlage einer kapitalistische ausgerichteten Ökonomie, die auf Wettbewerb und der Profitmaximierung basiert, bedeutet dies, dass der Handel nicht im Interesse von nachhaltiger Entwicklung betrieben wird und somit auch nicht zu einer Verbesserung der Lebensbedingungen oder der Umwelt führt. Große Konzerne schwärmen überall auf der Welt aus, um seltene Erden und Energieträger auszubeuten, ohne dabei an die Umweltauswirkungen vor Ort zu denken oder daran, welche Folgen ihr Tun für die lokale Bevölkerung hat. Sie suchen ständig nach billigeren Möglichkeiten, um produzieren zu können. Dabei scheren sie sich nicht um Arbeitnehmerrechte, den Gesundheitsschutz der Beschäftigten oder Sicherheitsstandards.
Indem sie über die „soziale Verantwortung der Unternehmen“ sprechen, versuchen die politischen EntscheidungsträgerInnen gemeinsam mit den Konzernen nur ihre ganz eigenen Vorstellungen zu verwirklichen. Reden kann man viel, wenn keine der Richtlinien zur „sozialen Verantwortung von Unternehmen“ bindend ist oder juristisch durchsetzbar. Die EU lobt sich selbst dafür, dass sie die Initiative ergriffen hat, um zu verhandeln, was sie selbst „Kapitel zur nachhaltigen Entwicklung“ nennt. Diese sollen zwar bei jeder Verhandlungsrunde Thema sein, müssen aber ebenfalls im Kontext mit den Wettbewerbsnachteilen gesehen werden, von denen europäische Unternehmen betroffen sein könnten, wenn es um die Konkurrenz mit dem Partner auf der anderen Seite des Ozeans geht. Normalerweise ist es so, dass die Richtlinien für den Umweltschutz und die Rechte von ArbeitnehmerInnen sowie Regulierungsmechanismen in der EU, die das Ergebnis des Drucks der Arbeiter- und Gewerkschaftsbewegung sind, höhere Standrads setzen. Von daher ist es gelegentlich ganz im Sinne der in der EU ansässigen Unternehmen, wenn Abkommen auch bestimmte Standards beinhalten, um im Wettbewerb nicht an Boden zu verlieren. Das heißt aber noch lange nicht, dass die EU eine an Nachhaltigkeit orientierte Handelspolitik betreibt.
Ein anderes Modell für den Handel
Es ist ganz offensichtlich, dass es hinsichtlich dieser Verhandlungen über die Kriterien für den transatlantischen Handel keine Transparenz gibt. Das ist ein weiterer Grund dafür, weshalb wir gegen diesen Prozess sind. Wir wollen eine Handelspolitik, in der die Mehrheit der Bevölkerung und ihre Interessen und Bedürfnisse bestimmen, wie diese auszusehen hat. Schließlich ist es auch die Bevölkerungsmehrheit, die den gigantischen Reichtum, der auf diesem Planeten vorhanden ist, erarbeitet. Sie hat aber kein Mitspracherecht, wenn es darum geht, wie und in wessen Interesse dieser Reichtum eingesetzt werden soll. Wir wollen eine Agenda für den Handel, die in puncto Umwelt, Soziales und Arbeitsrecht den höchstmöglichen Maßstäben entspricht und zur Weiterentwicklung der Gesellschaft sowie dem Schutz der Umwelt beiträgt.
Das wäre nur in einer Gesellschaft möglich, deren Strukturen völlig anders aussehen müssten als es heute der Fall ist. Wir stehen und kämpfen für eine Gesellschaft und für eine Handelspolitik, in der das Profitstreben ersetzt wird durch das Streben nach nachhaltiger Entwicklung der Menschheit und Solidarität. Es geht um eine Gesellschaft, die nicht ständig die Fundamente ihrer eigenen Existenz untergräbt sondern ihren Reichtum, ihr Wissen und ihr technisches know-how dazu benutzt, um die Menschen aus dem Elend und der Armut zu holen, in öffentliche Forschungsprojekte zu investieren, damit Krankheiten ausgelöscht werden können, der Klimawandel umgekehrt werden kann und der Umwelt als unser Lebensraum absolute Priorität beigemessen wird.